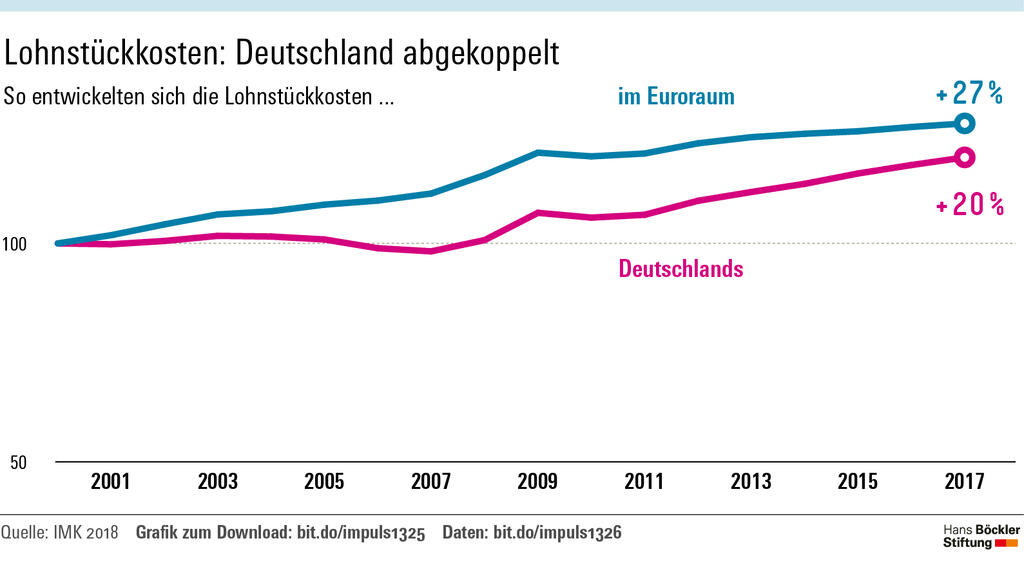Mit der deutschen Wiedervereinigung 1989/1990 betrat ein altes, fast vergessenes ökonomisches Phänomen wieder die wirtschaftspolitische Bühne: das Transferproblem.

Im ersten Teil dieser kleinen Serie habe ich mich bereits mit dem erstmaligen Auftauchen dieses Paradoxons in Form der Reparationsforderungen an das damalige Deutsche Reich nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Die Unlösbarkeit dieses Transferproblems hatte damals entscheidenden Einfluss auf das Abgleiten Deutschlands in die Depression der Wirtschaftskrise und die darauffolgenden dunklen Jahre der Nazizeit.