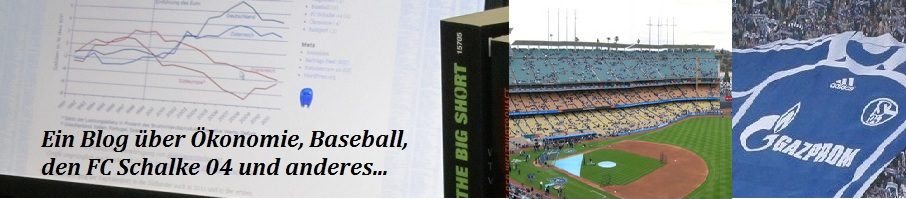Mit der deutschen Wiedervereinigung 1989/1990 betrat ein altes, fast vergessenes ökonomisches Phänomen wieder die wirtschaftspolitische Bühne: das Transferproblem.

Im ersten Teil dieser kleinen Serie habe ich mich bereits mit dem erstmaligen Auftauchen dieses Paradoxons in Form der Reparationsforderungen an das damalige Deutsche Reich nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Die Unlösbarkeit dieses Transferproblems hatte damals entscheidenden Einfluss auf das Abgleiten Deutschlands in die Depression der Wirtschaftskrise und die darauffolgenden dunklen Jahre der Nazizeit.
Die immer noch verpasste Chance
Deutschland 24 Jahre nach der Einheit. Einer Studie zufolge haben sich die Lebensverhältnisse der Boom-Regionen im Osten endlich denen der schwächsten Regionen im Westen angepasst.
Was aber ist mit den anderen? Denjenigen Städten und Landstrichen der ehemaligen DDR, die eben nicht „boomen“? Die unter hohen Arbeitslosenquoten, Entvölkerung ihrer Ortschaften und Vergreisung ihrer Städte durch Abwanderung der Besserqualifizierten leiden?
Nein, der größte Teil der damaligen Ostzone hat es auch heute noch nicht geschafft. Leider, kann man da sagen, aber unter dem Eindruck der globalisierten Marktwirtschaft offenbar auch mehr als zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung unvermeidbar.
Im Westen wird müde abgewunken: Wir haben doch schließlich genug getan für den Osten, noch immer fliessen die Transfers, es muss doch irgendwann mal reichen. Ansonsten herrscht Ratlosigkeit. Sicher, die Fremdenfeindlichkeit „da drüben“ ist zuweilen beängstigend, seit dem Auftauchen des NSU um Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe erst recht, aber auch da wollen wir es lieber nicht so ganz genau wissen.
Noch immer wählen zwanzig Prozent der Bevölkerung im Osten die LINKE, aber auch das ist nicht so wichtig, solange die bürgerlichen Mehrheiten in Gesamtdeutschland nicht wirklich in Gefahr sind.
Man hat sich allerorten abgefunden mit den Verhältnissen, so wie sie nun mal sind. Klar bräuchte der Osten noch viele Milliarden, um wenigstens die Infrastrukturversäumnisse irgendwie auszugleichen. Doch angesichts der ständigen Transfers wird der Ball flachgehalten, man möchte schließlich nicht undankbar erscheinen, die Zahler im Westen maulen eh schon vernehmlich genug.
Dann wird doch lieber gespart, weil das in den Zeiten von Globalisierung und Schuldenbremsen sowieso angesagt ist und ausgeglichene Haushalte das Ziel sind. Gleichzeitig wird aber auch darüber gestritten, ob und wie man „strukturschwache Regionen“ auch nach 2019 noch weiter fördern soll.
Währenddessen feilt man weiterhin an der weiteren Aushöhlung der Konvergenzziele der Einheit, mit denen man einst die „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ nach dem damaligen Artikel 72 des Grundgesetzes erreichen wollte.
Heute ist davon nicht mehr die Rede, wie oben bereits ausgeführt, geht es nur noch um das „weitgehende Aufschließen“ des Ostens „zu den strukturschwächeren Ländern“ im Westen.
Was aber ist passiert? Was ist schiefgelaufen? Warum hat sich das Verprechen Helmut Kohls, im Osten innerhalb weniger Jahre „Blühende Landschaften“ zu schaffen, nicht verwirklichen lassen?

Zwar wissen wir heute ganz genau, dass die deutsch-deutsche Währungsunion, denn um nichts anderes handelte es sich bei der Wiedervereinigung, bisher gescheitert ist, und bei den meisten Ökonomen ist es auch unbestritten, dass es der rasche Übergang zur harten D-Mark und die schnelle Lohnangleichung waren, die zum Abbau der ostdeutschen Industrie und der Festlegung dieser Länder zu reinen Transferempfängern geführt haben.
Wie aber genau sehen die wirtschaftspolitischen Mechanismen aus, die aufgrund der obigen Maßnahmen geradezu zwangsläufig das Gelingen dieser Währungsunion verhinderten?
Nun, da sind wir dann endlich angelangt bei dem Phänomen, um das es in dieser kleinen Artikelreihe geht, nämlich dem Transferproblem.
Rasche Angleichung der Einkommen entfachte das Transferproblem
Im Endeffekt ist es leicht zu erklären, warum der Schock der Wiedervereinigung die ostdeutsche Wirtschaft so schwer getroffen hatte. Es gab damals für Ostdeutschland nur theoretisch eine Wahl zwischen einer Anpassung der Löhne und Gehälter in kleinen aber steten Schritten an die Einkommen im Westen, oder aber eine möglichst zügige Angleichung in kürzester Zeit. In erstem Fall wäre eine möglichst große Sicherheit der Arbeitsplätze wohl machbar gewesen, während der zweite Weg sehr viele Arbeitsplätze definitiv aufs Spiel setzte.
Die Regierung Kohl aber hatte damals schon mit der Festlegung auf einen hohen Umtauschkurs Ostmark zu D-Mark politische Fakten geschaffen, die nur noch eine schnelle Angleichung der realen Einkommen übrig ließen. Pikanterweise war es somit die CDU, die 1990 mit dem Schlagwort „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ in den Bundestagswahlkampf ging.
Ohne eine vorherige Bewertung der möglichen ökonomischen Folgen hatte sich die westdeutsche Politik also sehr schnell darauf festgelegt, die Folgen des Aufholprozesses vor allem am Arbeitsmarkt zu übernehmen. Es ging also vornehmlich um Transfers, mit denen diese rasche Anpassung finanziert werden sollte und immer noch soll.
Im Prinzip handelte es sich um das gleiche Problem wie bei den Reparationsforderungen nach dem Ersten Weltkrieg, nur umgekehrt:
Ostdeutschland mußte (und muß auch weiterhin!) seine Wettbewerbsposition gegenüber dem Westen soweit verbessern, dass es dort Marktanteile gewinnen kann. Nur so ist es letztlich in der Lage, unabhängig von Transferzahlungen aus den alten Bundesländern zu werden. Es reichte und reicht nicht aus, nur an der gesamtdeutschen Entwicklung „dran“ zu bleiben, weil damit nur die aktuellen Lohnabstände zum Westen erhalten bleiben.
Logischerweise kann die ostdeutsche Wirtschaft Marktanteile nur dann dazugewinnen, wenn sie gegenüber der westdeutschen an Wettbewerbsfähigkeit Boden gut macht. Das bedingt aber gleichzeitig für den Westen einen wirtschaftlichen Verlust, damit am Ende alle zu den Gewinnern gehören können.
Damit ist das wieder ein Anwendungsfall der volkswirtschaftlichen Saldenmechanik, gemäß der ja bekanntlich Geldschulden und Geldvermögen immer exakt gleich sind, weil die Ersparnisse des einen die Schulden des anderen sind.
Dieser einfachen ökonomischen Logik ist die deutsche Wirtschaftspolitik immer aus dem Weg gegangen. Stattdessen ging es stets nur darum, beides zu erreichen: die Transfers sollten so schnell wie möglich verschwinden, aber an der wirtschaftlichen Überlegenheit des Westens durfte nicht Hand angelegt werden.

Dieser Stand der Debatte ist auch heute 24 Jahre nach der Einheit unverändert.
Eine endgültige Lösung des Transferproblems steht immer noch aus
Noch immer klafft eine Lücke von fast 30 Prozent zwischen der Produktivität der ost- und westdeutschen Industrien, noch immer können die Länder im Osten ihre Ausgaben nur zur Hälfte aus eigenen Einnahmen decken. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch wesentlich höher als im Westen, die Lohnstückkosten haben sich immer noch nicht entscheidend angeglichen. Man spricht immer noch von den Rückständen in der Infrastruktur und erwartet immer noch notwendige Solidarität, möglicherweise auch über 2019 hinaus.
Im Gegensatz dazu fordern manche Politiker sogar das Auslaufen der Förderung oder zumindest das Verstecken der Transfers in den Regelungen des Länderfinanzausgleichs.
Doch all das geht nach wie vor an der eigentlichen Problematik eklatant vorbei. Es ist immer noch so, dass die Transferleistungen zur Zeit den Osten lediglich dazu verhelfen, den Status Quo zu erhalten, aber seine Position gegenüber dem Westen nicht oder nur wenig zu verbessern. Ohne eine wesentliche Steigerung dieser Position aber kann man auch die Transfers nicht zurückfahren, weil dann die Einkommensabstände sich wieder vergrößern würden.
Um aufholen zu können, muß daher in den neuen Bundesländern die Produktivität mehr als im Westen steigen. Noch immer aber gilt auch, dass die Produktivität nur dann stärker steigen kann, wenn sie von Staat und Unternehmern getragen wird. Eine Förderung der Nachfrage allein durch die Löhne wird verpuffen, da sie aufgrund des immer noch vorhandenen Wettbewerbrückstandes nur zu noch höheren Importen führen würde.
Es geht also weiter um größere Anreize für Unternehmer, ihre Produktion in den Osten zu verlagern und um mehr Ausgaben für die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur.
Doch das genaue Gegenteil passiert. Der Osten soll sowohl durch die deutsche als auch die europäische Politik zu einer normalen Region mit Strukturschwächen eingestuft und damit jeglicher Sonderförderung entzogen werden. Es ist aber der entscheidende Unterschied, dass die neuen Bundesländer eben keine aufgrund von geographischen, strukturellen oder anderen natürlichen Gründen zurückgebliebene Region sind, sondern aufgrund eines auf staatlichen Zwang aufgebauten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in diese „Lage“ geraten sind.
Eine Veränderung bedingt daher zwingend die Lösung des Transferproblems, dafür aber muss man die Existenz dieses Dilemmas überhaupt erst einmal anerkennen.
So ist dieses Problem weiterhin nicht beseitigt, obwohl es seit einem Vierteljahrhundert die Geschicke vieler Menschen im Osten maßgeblich beeinflusst und verschlechtert. Die wahren Gründe dafür aber sind den wenigsten Betroffenen tatsächlich bewusst, von der Politik werden sie sowieso mit aller Macht ignoriert.
Das aber hinderte die Verantwortlichen nicht daran, es ein paar Jahre später noch einmal zu versuchen: Dieses Mal jedoch in einem weit größeren Maße, nämlich im Rahmen der europäischen Währungsunion.
Zu lesen in Teil 3: Die Eurokrise – vorläufiger Höhepunkt der Transferproblematik.