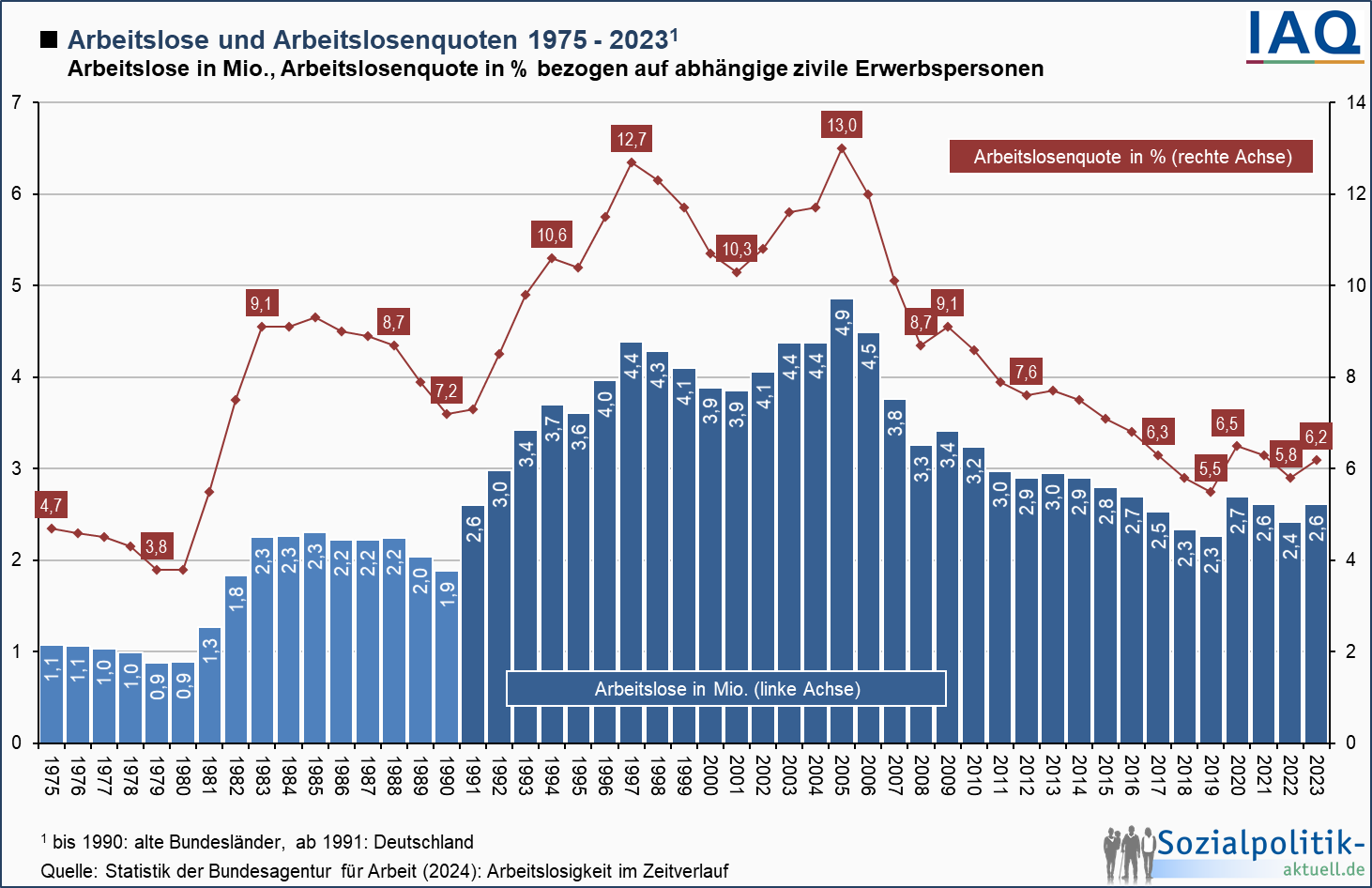Keynesianer stöhnten erschrocken auf, während Monetaristen und Neoliberale eine gewisse Genugtuung offenbar nicht verhehlen konnten, denn die FAZ meldete dieser Tage: Japans Wirtschaft steckt in der Rezession.

Shinzo Abe, Premierminister von Japan
Handel, Dienstleistungen und Industrie im Land der aufgehenden Sonne sind im 3. Quartal 2014 überraschend geschrumpft, die umstrittene Reform-Strategie von Premierminister Shinzo Abe, Abenomics genannt, stehe angeblich vor dem Scheitern.