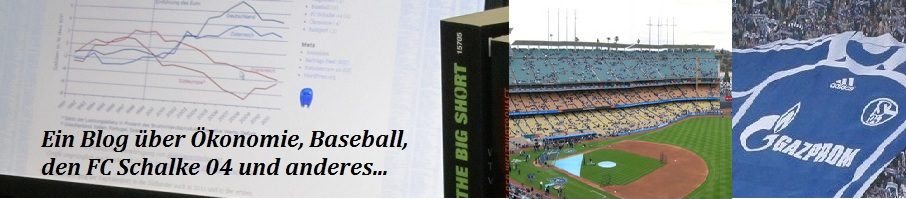Seit ich mich nach der Finanzkrise von 2007 intensiv begonnen habe mit Ökonomie und Wirtschaftspolitik zu befassen, ging es mir auch immer wieder darum, anhand historischer Beispiele Parallelen zur nachfolgenden Weltwirtschaftskrise zu ziehen und über mögliche Lehren aus der Geschichte nachzudenken.

Kaufhaus Wertheim, Berlin Leipziger Platz in den 1920er Jahren
Aus vielerlei Gründen rückten da vor allem die Auswirkungen der ersten Weltwirtschaftskrise 1929 in den Fokus, insbesondere das Ende der Weimarer Republik. Natürlich ging es dabei dann auch um die umstrittene Frage nach der Auslotung der wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der Regierung Brüning.
Doch diese Debatte ist nicht wirklich neu. Bereits 1979 veröffentlichte Knut Borchardt mehrere Arbeiten, in denen er sich mit den „Zwangslagen und Handlungsspielräumen“ des Kabinetts Brüning Anfang der 1930er Jahre in der Bankenkrise genauer auseinandersetzte.
Diese Veröffentlichungen, auch als die „Borchardt-Hypothese“ bezeichnet, lösten in der Folgezeit eine heftige Kontroverse aus. Borchardt hinterfragte dabei die Tatsache, warum die Regierung Brüning keine Konjunkturpolitik zur Eindämmung der Krise betrieben habe wie die darauffolgenden Kabinette.
Er kam dabei zu dem umstrittenen Ergebnis, dass es vor allem zwei Gründe waren, die in der damaligen Situation eine solche Politik unmöglich machten:
Entgegen der in den 1970er Jahren weit verbreiteten Ansicht, Brüning habe eine freiwillig gewählte Deflationspolitik verfolgt, mit der er in den frühen 1930ern den Krisenverlauf im Deutschen Reich entscheidend verschärft und somit Hitler den Weg bereitet habe, war Borchardt der Meinung, dass es verschiedene Zwangslagen gab, die keine Alternativen zur durchgeführten Politik gestatteten.
Zweitens stellte er die These auf, dass die deutsche Wirtschaft bereits vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise durch Verteilungsprobleme so entkräftet gewesen sei, sodass sie von den Auswirkungen der Krise außerordentlich schwer getroffen wurde.
Borchardt begründete diese Behauptung mit einer Investitionsschwäche in Deutschland während der sogenannten Goldenen Zwanziger, die er auf die sich in dieser Zeit angeblich weiter geöffnete „Schere“ zwischen Lohnkostenanstieg und Produktivitätsentwicklung zurückführte.
Die Zwangslagen während der Großen Krise sind nicht Hauptthema dieses Beitrags
Über die Motivation der Regierung Brüning in der Krise der Weimarer Republik gab es lange Zeit in der Geschichtswissenschaft einen breiten Konsens:
Ihre Politik wurde im allgemeinen und vor allem im Hinblick auf den Aufstieg der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und ihren epochalen Folgen zumeist als verhängnisvoll und völlig falsch beurteilt.
Erst Knut Borchardt lieferte mit seinen Arbeiten einen kritischeren Ansatz und behandelte dabei auch die Frage, warum Brüning keine Konjunkturpolitik zur Überwindung der Depression betrieben habe.
Er stellte dabei die Behauptung auf, dass die damalige wirtschaftliche und politische Situation eine solche geforderte Politik unmöglich gemacht habe.
Ich möchte jetzt hier nicht weiter in die Kontroverse um diese Thematik einsteigen, dass haben vor mir schon andere, vor allem der Wirtschaftshistoriker Carl-Ludwig Holtfrerich in seinem Aufsatz Alternativen zu Brünings Wirtschaftspolitik in der Weltwirtschaftskrise? bereits vor einiger Zeit getan.
Es ist letztlich eine Frage der persönlichen Gewichtung historischer Ereignisse, inwieweit man lieber den Argumenten Borchardts oder denen seiner Gegner wie Holtfrerich folgen will.
So halte ich beispielsweise Borchardts These der mangelnden Unterstützung möglicher alternativer Handlungsmuster durch politische und gesellschaftliche Kräfte für eher wenig stichhaltig. Die zustimmende oder zumindest wohlmeinende Haltung einiger Minister, von Teilen der SPD, der Gewerkschaften, sowie von wie bereits im ersten und zweiten Teil beschrieben auch einer stattlichen Anzahl von damals durchaus prominenten Ökonomen, von Regierungsbeamten und sogar eines Teils der „Industriebarone“ gelten allgemein als historisch belegt.
Auch die Ansicht, dass vor allem von außen vorgeschriebene Faktoren wie die Einhaltung des Reichsbankgesetzes (welches auf Druck der Alliierten zustande gekommen war) sowie einschränkende außenpolitische Verträge die Handlungsmöglichkeiten entscheidend reduzierten, kann man in dieser Form nicht wirklich gelten lassen.
Holtfrerich wies beispielsweise nach, dass „seit der Bankenkrise vom Juli 1931 die vorgeschriebene 40%-Deckung des Reichsbanknotenumlaufs in Gold und Devisen mit Ausnahme von vier Wochen andauernd unterschritten wurde.“ (vgl. Holtfrerich, siehe oben, S. 618).
Diese von Borchardt als unumgänglich bezeichnete Regelung wurde also in der Praxis wenn überhaupt nur lückenhaft eingehalten.
Ebenso halte ich die anderen internationalen Abkommen und Verträge wie z. B. den Young-Plan zum Zeitpunkt der Krise als nicht mehr wirklich hinderlich. So hatte dieser Plan bereits im Juni 1931, also noch vor der Konferenz der Fridrich-List-Gesellschaft im September, durch das Hoover-Moratorium faktisch keine bindende Wirkung mehr. Entgegen den Behauptungen Borchardts agierte die Regierung Brüning ab dem Sommer 1931 damit eigentlich in einem nicht geregelten internationalen Rahmen, in dem es vor allem auf hartnäckigere Verhandlungen mit den Alliierten, allen voran mit den bremsenden Franzosen angekommen wäre.
Im Gegensatz zu Brüning konnte dann sein Nachfolger Franz von Papen bei der Konferenz von Lausanne im Juni/Juli 1932 sehr wohl Verhandlungserfolge vorweisen. Es gibt daher wenig Gründe anzunehmen, dass ein ähnlicher Fortschritt bei nur unwesentlich anderen politischen Bedingungen nicht schon vorher möglich gewesen wäre.
Auch der Einwand, ohne Geldschöpfung und damit einer erneuten Inflationsgefahr sei eine nachhaltige expansive Konjunkturpolitik nicht möglich gewesen, halte ich nach der Lektüre des Lautenbach-Plans für nicht stichhaltig. Wie in den vorherigen Teilen dieser Serie mehrfach angeführt, sah der Vorschlag von Wilhelm Lautenbach kompensierende Maßnahmen vor, um gerade keine Inflation zu erzeugen.
Glaubwürdiger ist da meiner Ansicht nach die Meinung von Holtfrerich und anderen Kritikern, Borchardt habe eigentlich die damalige wirtschaftliche Lage Deutschlands in den 70ern ansprechen und mit dem Vergleich eher die Wirkung nachfrageorientierter Maßnahmen diskreditieren wollen.
Die „Krise vor der Krise“ aufgrund vermeintlich unangemessen hoher Löhne
Ökonomisch interessanter finde ich allerdings die Auseinandersetzung mit dem zweiten Argument Borchardts: Waren tatsächlich zu hohe Löhne die Ursache für die Investitionsschwäche in der Weimarer Republik oder gab es damals andere Gründe für die Probleme der deutschen Wirtschaft?
Neben der Abhängigkeit der damaligen Wirtschaft von Auslandskrediten hätten die Investitionen zwischen 1925-29 nie wieder das Niveau von vor dem Krieg erreicht, zudem stieg in dieser Zeit der private Konsum unverhältnismäßig. Gleiches habe laut Borchardt auch für die Arbeitsproduktivität gegolten. Bis Ende der 1920er Jahre erreichte diese demnach nicht wieder das Vorkriegsniveau, während gleichzeitig aber die Löhne anstiegen.
Da die Unternehmer aufgrund der internationalen Konkurrenz und der festen Wechselkurse die höheren Löhne nicht auf die Preise anrechnen konnten, hätten sie weniger Gewinne für Investitionen zur Verfügung gehabt. Da sich diese Entwicklung bereits vor der Krise in der Höhe der Erwerbslosigkeit projiziert habe, sei das Dilemma der Regierung Brüning eine „alternativlose“ Deflationspolitik zur Angleichung der Löhne gewesen.
Holtfrerich zog bereits 1984 mit seinem Aufsatz Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Demokratieverlust: Ergebnis zu hoher Löhne in der Weimarer Republik? die Berechnungen Borchardts zur Kostenneutralität der Löhne und Gehälter erheblich in Zweifel und war der Ansicht, dass eine falsche Datenbasis das Ergebnis verzerren würde. So musste selbst Borchardt einräumen, dass die von ihm verwendeten Daten, die auf dem Werk „Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts“ von Walther G. Hoffmann beruhten, „mit einigen Unsicherheiten behaftet“ seien.
Zudem führte Holtfrerich auch die Arbeiten von Barry Eichengreen an, der die Nominal- und Reallöhne der Weimarer Republik in einen internationalen Vergleich stellte und dabei zu dem Ergebnis kam, dass der deutsche Arbeitsmarkt besser funktionierte als in anderen Industriestaaten und die Lohnstückkosten trotz eines Anstiegs seit 1927 auch 1929 ihr Niveau aus der Zeit vor dem Krieg noch nicht wieder erreicht hätten.
Bei meinen Recherchen zum Thema Lohnstückkosten in der Weimarer Republik fiel mir zudem noch eine neuere Arbeit von Stephen Broadberry und Carsten Burhop in die Hände, die erstmals 2010 im Journal of Economic History der Universität Cambridge veröffentlicht wurde: Real Wages and Labor Productivity in Britain and Germany, 1871–1938: A Unified Approach to the International Comparison of Living Standards.
Darin verglichen die beiden Forscher die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter in Großbritannien und Deutschland zwischen 1871 und 1938 unter Berücksichtigung von Reallöhnen und Produktivität sowie der Wettbewerbsfähigkeit der Gesamtwirtschaft und der Sektoren Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen.
Zur Borchardt-Kontroverse kamen sie zu folgendem Fazit:
Our results confirm Knut Borchardt’s finding that comparative unit labor costs indeed increased substantially in Weimar Germany compared to the prewar period, particularly in industry.However, by considering levels as well as rates of change of both real wages and labor productivity on a comparative basis, we are able to show that German industrial workers were still poorly paid in an international perspective, given their relatively high productivity.
Übersetzung: Unsere Ergebnisse bestätigen Knut Borchardts Feststellung, dass die Lohnstückkosten in Weimar im Vergleich zur Vorkriegszeit insbesondere in der Industrie tatsächlich stark gestiegen waren.
Jedoch unter der Berücksichtigung von Niveau und Veränderungsraten sowohl der Reallöhne als auch der Arbeitsproduktivität auf vergleichbarer Basis sind wir in der Lage zu zeigen, dass die deutschen Industriearbeiter angesichts ihrer relativ hohen Produktivität im internationalen Vergleich immer noch schlechter bezahlt wurden.
Real Wages and Labor Productivity, 2010, S. 403
Bemerkenswerterweise blieben die deutschen Löhne in der Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und den 1920er Jahren immer hinter den britischen Vergleichslöhnen zurück:
There was a period of disorder between 1913 and 1925, during which German real wages suffered a major setback. By 1925 the comparative real income position of a German worker had fallen back to 76 percent of the British level versus 83.3 percent in 1913. Although Germany/U.K. comparative real wages recovered by 1928, the Great Depression hit Germany much more severely than Britain.
Übersetzung: Es gab eine Zeit der Störungen zwischen 1913 und 1925, in der die deutschen Reallöhne einen schweren Rückschlag erlitten. Bis 1925 war das Vergleichsrealeinkommen eines deutschen Arbeiters bis auf 76 Prozent der Briten gegenüber 83,3 Prozent im Jahr 1913 gesunken. Zwar konnte sich das Verhältnis der Reallöhne Deutschland / U.K. bis 1928 etwas erholen, trotzdem traf die große Wirtschaftskrise Deutschland viel stärker als Großbritannien.
Real Wages and Labor Productivity, 2010, S. 411
In der Zusammenfassung ist besonders der letzte Satz von Bedeutung, mit dem die beiden Professoren festhielten, dass die Entwicklung der Arbeitsproduktivität der Gesamtwirtschaft sich in beiden Ländern ähnlich wie die der Reallöhne vollzog.
Dies bedeutet aber dann nicht anderes, als dass in dem gesamten Vergleichszeitraum die Lohnstückkosten in Deutschland niedriger gewesen sein müssen als in Großbritannien.
Deutsche Übersetzung:
Dieser Artikel bietet eine vergleichende Perspektive auf den Lebensstandard in Großbritannien und Deutschland über den Zeitraum 1871-1938, mit einem einheitlichen Ansatz, der sowohl die Reallöhne als auch die Arbeitsproduktivität umfasst.Für die Wirtschaft als Ganzes betrugen die deutschen Reallöhne etwas weniger als drei Viertel der britischen Vergleichslöhne in den frühen 1870er Jahren.
Nach dem Krieg und der Nachkriegsinflation sanken die deutschen Reallöhne wieder auf etwa drei Viertel des britischen Niveaus von 1924 und hatten am Vorabend des Zweiten Weltkriegs lediglich bis zu 83 Prozent der britischen Löhne erreicht.
Im Durchschnitt wurden die britischen Arbeiter damals über den gesamten Zeitraum besser bezahlt als ihre deutschen Kollegen.Für die Gesamtwirtschaft lagen die Vergleichsreallöhne auf dem gleichen Niveau wie die Arbeitsproduktivität…
Real Wages and Labor Productivity, 2010, S. 422
Logischerweise kann dieses Ergebnis dann die Behauptung Borchardts, die Lohnstückkosten in Deutschland seien schon vor der Weltwirtschaftskrise „unangemessen“ gestiegen, eher nur widerlegen.
Zwar fanden die Autoren einige Unterschiede im Vergleich der Sektoren, so wurden die Beschäftigen im Dienstleistungssektor in Deutschland im Verhältnis zu ihrer Produktivität besser bezahlt als ihre Kollegen in England, während für die Bereiche Landwirtschaft und vor allem die Industrie die Verhältnisse genau umgekehrt waren.
Doch für die Gesamtwirtschaft, und das ist der entscheidende Faktor, kamen sie zu dem Ergebnis, dass die deutschen Arbeiter unter Berücksichtigung der Produktivität immer schlechter als die Briten entlohnt wurden. Dies aber nimmt Borchardts These der zu hohen deutschen Lohnstückkosten jegliche Spitze und lässt sie eher unwahrscheinlicher erscheinen.
Fazit:
Zusammenfassend kann ich aufgrund der oben angeführten Argumente Borchardts Thesen nicht als wirklich stichhaltig empfinden. Mir kommen sie eher wie „Ausreden“ vor, um sich nicht mit dem eigentlichen Kern der Sache, der historischen Verantwortung der Regierung Brüning für ihr eigenes Handeln, beschäftigen zu müssen. Sicher, es ist müßig darüber zu diskutieren, ob nun andere Entscheidungen tatsächlich Veränderungen herbeigeführt hätten. Die Geschichte ist nun einmal anders verlaufen, was wäre wenn basiert letztlich immer nur auf Vermutungen.
Allerdings deuten die Erfolge von Brünings Nachfolgern, die eben genau mit den von ihm abgelehnten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (jedoch unter von Papen mit eindeutiger Bevorzugung der Unternehmer und unter den Nazis als beginnende Kriegsvorbereitung) die Krise und damit auch den Höhepunkt der Beschäftigungslosigkeit überwanden, ganz klar darauf hin, dass natürlich eine alternative Politik möglich gewesen wäre.
Doch das ist gar nicht der Punkt: Es geht schlicht nicht um die Wahrscheinlichkeit, mit der beispielsweise Brüning in möglichen weiteren Verhandlungen mit den Alliierten mehr Zugeständnisse erreicht haben könnte. Das werden wir sowieso nie erfahren, weil es eben so nicht gekommen ist.
Es geht letztlich vor allem darum, dass diese Regierung eine andere Politik als die von ihr exerzierte Deflationspolitik nicht einmal versucht hat! In ihrer ideologischen und dogmatischen Festlegung auf ihre wirtschaftsorthodoxen Vorstellungen von der „Armut der Nation“ war eine staatliche „Ankurbelung“ der Wirtschaft mittels kreditfinanzierter Maßnahmen schlicht nicht vorgesehen! Brüning hatte nichts anderes vorgehabt, als seine eigenen innen- und außenpolitischen Ziele durchzusetzen, unter Inkaufnahme sozialer Verwüstung und Verelendung.
Es ist daher die historische Schuld Brünings und seines Kabinetts, dass man nicht alles ausprobiert hat, um die Krise schneller und mit weniger Opfern zu überwinden. Es ist ihre historische Schuld, nicht auf die Fachleute wie Wilhelm Lautenbach gehört zu haben, die ihnen Möglichkeiten zu einer anderen Politik an die Hand gegeben hatten. Und es ist natürlich auch ihre Schuld, den radikalen Kräften der Weimarer Republik in Sachen Konjunkturprogrammen nichts entgegengesetzt zu haben und so den Wahlerfolg der NSDAP und damit den Aufstieg Hitlers nicht verhindert zu haben.
Daher halte ich es eher wie Christoph Plumpe, einem weiteren Borchardt-Kritiker, der 1985 schrieb:
„Brünings Scheitern war nicht zwangsläufig, ebensowenig wie seine Wirtschafts- und Sozialpolitik alternativlos, die auch ohne Absicht wesentliche Wegbereiter- funktionen für die Errichtung der Diktatur besaß.“
Plumpe, Wirtschaftspolitik in der Weltwirtschaftskrise, S. 356
Und der Begriff „alternativlos“ stellt dann auch die wichtige Verbindung zur heutigen Zeit her, in der man ungeachtet der unterschiedlichen Historie deutliche Parallelen in der Krisenpolitik erkennen kann. Auch heute sind wieder Ausgabenkürzungen bei Löhnen und beim Staat und reparationspolitisches Denken die angeblich „alternativlosen“ Lösungsansätze der orthodoxen Wirtschaftspolitik.
Doch die intensive Beschäftigung mit der Krise der Weimarer Republik und ihren Folgen zeigt eindeutig, dass es auch andere Wege gegeben hat und heute immer noch gibt.