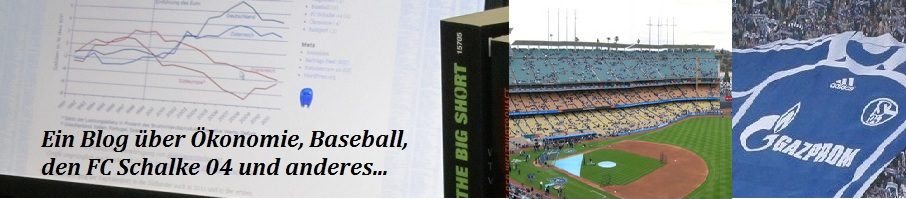Es hatte schon eine gewisse Ironie an sich, dass nur wenige Jahre nach der missglückten deutschen Wiedervereinigung, als die Europäische Währungsunion in die entscheidende Phase ihrer Vorbereitung ging, innerhalb der deutschen Politik die vorsichtigen Einsichten über die deutsch-deutschen Lehren aus der Unlösbarkeit des Transferproblems sehr schnell wieder in Vergessenheit gerieten.
Die sich anbahnende Diskussion, welche Länder zu welchen Bedingungen dem europäischen Währungsverbund beitreten würden, überlagerte sofort alle Fragen zum grundsätzlichen Rahmen, der ein dauerhaftes Bestehen in einer solchen Union überhaupt erst möglich machen könnte.
Gerade auf deutscher Seite, dessen Volksvertreter kurz vorher erst eine eigene Währungsunion hatten scheitern lassen, kam niemand auf die Idee, darüber nachzudenken, warum dies so gekommen war.
Stattdessen stürzte man sich mit neuem Eifer und erstaunlicher Einigkeit auf die Feststellung, dass die Europäische Währungsunion (EWU) mindestens genauso eine stabile Veranstaltung werden solle wie Deutschland nach dem Ende des Währungssystems von Bretton Woods (bei dem der US-Dollar als Leitwährung über feste Wechselkurse mit den europäischen Währungen verbunden war) seit Anfang der 70er Jahre.
Bei den zu vereinbarenden Konvergenzkriterien spielten vor allem der Schuldenstand und die aktuelle Verschuldung der Staaten ebenso wie die Inflationsraten eine wichtige Rolle, die neu zu schaffende Europäische Zentralbank sollte vor allem an ihrer Unabhängigkeit gemessen werden.
Doch die Frage, wie denn ein Ausgleich von Verlusten an Wettbewerbsfähigkeit erfolgen sollte, da ja die Möglichkeit der Abwertung der eigenen Währung nun nicht mehr gegeben sein würde, wurde nicht gestellt. Ebenso wenig wurde darüber geredet, wie sich denn die Löhne bzw. die Lohnstückkosten in der europäischen Währungsunion entwickeln sollten.
Daran sollte sich auch in der Folgezeit bis zum Ausbruch der „Euro-Krise“ als Ergebnis des Fast-Zusammenbruchs des westlichen Finanzsystems nichts ändern. Zwar ist man sich heute im Großen und Ganzen einig, dass es der rasche Übergang zur D-Mark und die schnelle Lohnangleichung waren, die die deutsch-deutsche Währungsunion scheitern ließen und den deutschen Osten zu einem Transferempfänger degradiert hatten, doch Lehren für die Vereinigung der europäischen Währungen zog aus diesem Wissen so gut wie niemand.
So traf denn die europäische Währungsunion die Krise aus heiterem Himmel, und der Weg in eine ähnliche Transferunion über den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit einiger Länder aufgrund des deutschen Lohndumpings wurde lange ignoriert oder gar nicht verstanden.
Es wurde sogar lange Zeit (und wird heute immer noch von deutschen Experten und Medien) vehement bestritten, dass die EWU seit 1999 in einem atemberaubenden Tempo genau das Gleiche wie bei der deutschen Währungsunion durchmachte.
Ganz im Gegenteil, die Tatsache, dass Deutschland durch die Lohnsenkungen im Verhältnis zu seiner Produktivität und im Verhältnis zu seinen Partnerländern massive Marktanteile und riesige Überschüsse im Außenhandel gewann und eben diese Länder in ein gewaltiges Leistungsbilanzdefizite trieb, galt als völlig problemlos.
Erst 2008 begann verschiedenen europäischen Wirtschafts- und Finanzministern langsam zu dämmern, was sich da abseits der ständigen Konzentration auf staatliche Schulden und der Angst vor Inflation tatsächlich getan hatte.
Vor den verblüfften Vertretern der deutschen Politik wurde erstmals positiv über die Lohnabschlüsse in Deutschland gesprochen, nach Jahren der Stagnation seien die Zuwächse ja allmählich notwendig gewesen. Selbst der damalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet konnte die Tatsache nicht mehr übersehen, dass innerhalb der EWU eine gewaltige Lohnlücke entstanden war, die Deutschland einen riesigen Wettbewerbsvorsprung verschafft und viele Mitgliedsstaaten in eine ausweglose Situation manövriert hatte.
So hatten sich von der Gründung der EWU 1999 bis 2008 die durchschnittlichen Lohnkosten zur Erstellung eines Produktes (die Lohnstückkosten) wie in obiger Abbildung in den verschiedenen Mitgliedsländern sehr unterschiedlich entwickelt, während sie in Deutschland nur wenig gestiegen waren, lag der Kostenanstieg in Frankreich und Südeuropa aber auch im Durchschnitt der gesamten Währungsunion wesentlich höher.
Diese dramatische Entwicklung der Kosten hatte gravierende Folgen für die Handelsströme: günstigere Produktion führte zu mehr Exporten und weniger Importen, infolgedessen sich der deutsche Leistungsbilanzsaldo von einem leichten Defizit 1999 zu einem gigantischen Überschuss von 180 Milliarden Euro (7,5 Prozent des BIPs) in 2007 entwickelte.
Spiegelbildlich mussten die kostenintensiveren Länder gewaltige Defizite ihrer Leistungsbilanzen hinnehmen.
Um die verheerenden Folgen dieser Entwicklung wieder einigermaßen ausgleichen zu können, müssten die Löhne in Deutschland über einen langen Zeitraum weit stärker als die Produktivität und die gemeinsam vereinbarte Inflationsrate steigen, damit die südeuropäischen Länder bei entsprechend geringerer Steigerung am Ende ihre Güter wieder zu einem ähnlichen Preis auf den Weltmärkten anbieten könnten.
Selbst dann aber hätten diese Länder während dieser Zeit immer noch Marktanteile an Deutschland verloren, da deren Kostenniveau trotz der Anpassungen zwar sinken würde, aber trotzdem noch höher als das deutsche wäre. Während dieser Zeit würden die Verbindlichkeiten Südeuropas gegenüber Deutschland weiterhin steigen, während die Leistungsbilanzdefizite langsam geringer würden.
Erst wenn diese Länder Leistungsbilanzüberschüsse im Vergleich zur Bundesrepublik erzielen könnten, wären sie überhaupt in der Lage, sich nicht weiter gegenüber Deutschland zu verschulden und erst dann könnte man über den Beginn der Schuldenrückzahlung nachdenken.
Solange aber die Bilanzdefizite erhalten bleiben, sind diese Staaten auf Transfers angewiesen, um die Güter der wettbewerbsfähigeren Staaten kaufen zu können bzw. Deutschland muss seinen Kunden die Kredite zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um seine Exportüberschüsse ihnen gegenüber aufrecht zu erhalten.
Anfang 2009 versuchte die EU-Kommission erneut, mittels einer vertraulichen Studie über das Auseinanderdriften der Wettbewerbsfähigkeiten innerhalb der Eurozone die Aufmerksamkeit der Politik für diese Thematik zu erringen. Doch außer dem allseitigen Erstaunen, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte, hatte auch dieser erneute Anlauf keinen Erfolg.
In den folgenden Jahren wurden die rein logischen Auswirkungen der Transferproblematik innerhalb der Europäischen Währungsunion in Deutschland weiterhin und bis heute von großen Teilen der Politik und den Medien schlicht ignoriert. Stattdessen zwingt man die stark verschuldeten Länder mittels Austeritätspolitik, sogenannter Strukturreformen und einseitiger Wettbewerbsanpassung weiter in die wirtschaftliche Abwärtsspirale.
Dabei wird immer wieder versucht, die deutsche Lohnsenkungspolitik als ein Erfolgsmodell zu verkaufen, während sie tatsächlich längst halb Europa tief ins Leistungsbilanzdefizit getrieben hat.
Die EWU-Partnerländer waren aber nicht nur in der Vergangenheit die Verlierer, sie werden es auch in der Zukunft weiterhin bleiben, bis entweder der oben beschriebene Anpassungsprozess bei den Lohnstückkosten vollzogen wurde oder sie als einzige tatsächlich mögliche Alternative aus dem Euro ausgetreten sind.
Denn dann stünde ihnen wieder ein Anpassungsmittel zur Verfügung, wie es jeder Staat mit einem eigenständigen Geldwesen hat: die Abwertung dieser eigenen Währung.
So ist also die Eurokrise die bisher größte und letzte Erscheinungsform des Transferproblems in der wirtschaftspolitischen Geschichte. Es bleibt abzuwarten, ob die Lehren aus den bisherigen Auftritten noch einmal aus der offensichtlichen Vergessenheit geholt werden können.
Beunruhigend ist dabei aber, dass die Problematik der Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg erst durch die deutsche Niederlage in einem erneuten globalen Ringen endgültig gelöst werden konnte, während die deutsch-deutsche Währungsunion nach 25 Jahren immer noch unvollendet ist.
Keine guten Voraussetzungen für die Hoffnung auf ein möglichst glimpfliches Ende der aktuellen Krise.