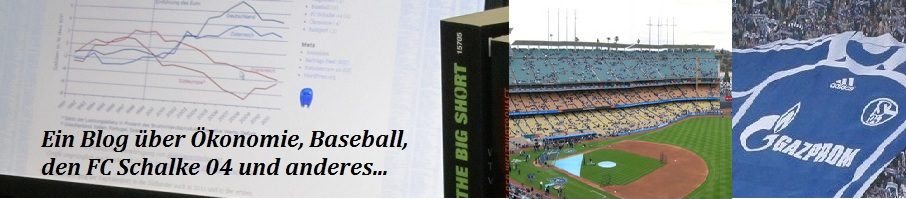Beim Aufspüren der Ursachen der Finanzkrise ab 2007 halten immer noch viele Experten die expansive amerikanische Geldpolitik in den Jahren nach der Dotcom-Blase für einen der maßgeblichen Gründe für die Entstehung der Krise.

Auch die Bundeskanzlerin und der Sachverständigenrat waren sich sehr frühzeitig bereits 2008 weitgehend einig, dass es schlicht am „zu vielen Geld“ als eine der Hauptursachen für das Auftreten der Misere lag.
Sicherlich gab es zusätzlich auch noch erhebliche Regulierungmängel an den Finanzmärkten in den USA und Großbritannien, die durch schärfere Kontrollen und Reformen eigentlich schon vorher hätten beseitigt werden müssen.
Doch ohne die Politik des billigen Geldes, für die vor allem der damalige Vorsitzende der amerikanischen Notenbank FED Alan Greenspan geradezu sinnbildlich steht, wäre nach einhelliger Ansicht ein solches Desaster nicht möglich gewesen.
Die Argumentation klingt vordergründig schlüssig: jahrelange zu niedrige Zinsen der amerikanischen Notenbank ermöglichten die massenhafte Vergabe äußerst bedenklicher Hypothekenkredite. Wären die Zinsen höher gewesen, so hätten sich die US-Amerikaner nicht so einfach dermaßen verschulden und auf Pump konsumieren können.
Folglicherweise wäre es auch nicht zu einer so gigantischen Auslandsverschuldung der USA gekommen und hätte sich die Krise auch nicht über die ganze Welt verbreiten können.
Es handele sich also vor allem um ein Versagen des Staates und der Politik in Form einer falschen Zinssteuerung und einer zu laxen Kontrolle und Regulierung der Finanzmärkte, das in erster Linie zu diesem desaströsen Ergebnis geführt habe. Diese Argumentation ist natürlich Wasser auf die Mühlen all jener, die ein Marktversagen schon immer als unmöglich ausgeschlossen hatten. Ebenso läßt sich damit jegliche Kritik an der momentanen Zinssenkungspolitik der Europäischen Zentralbank bestens unterlegen.
Doch wie stichhaltig ist dieser Vorwurf eigentlich, wenn man einmal die monetaristischen Lehrsätze von der Kontrolle der Geldmenge durch die Notenbanken außer Acht lässt?
Da aber keine Zentralbank der Welt Geld mit Helikoptern verteilt oder in irgendeiner anderen Form das Geldangebot festlegt, bleibt lediglich die Festsetzung des kurzfristigen Zinses als vorrangige Aufgabe der Geldpolitik übrig, ein Zusammenhang, auf den ich bereits auch in diesem Blog mehrfach hingewiesen habe.
Welche Kreditsumme bei einem bestimmten Zinsniveau entsteht, ist aber völlig offen. So kann es „zu viel“ Geld gar nicht geben, da ansonsten der Zins eigentlich immer Null sein müsste. Ebenso wenig hängt es von irgendeiner Geldmenge ab, wer welche Kredite in welcher Höhe erhält, ob eher vertrauensvolle oder höchst zweifelhafte Schuldner dabei Berücksichtigung finden. Es sind vielmehr nur die gesetzlichen Regelungen und vor allem die Entscheidungen der Banken und Finanzinvestoren, die über das Entstehen der Kreditsummen entscheiden.
Auch auf die Art und Umfänge der Kreditbeziehungen zwischen In- und Ausländern sowie die Sparversuche der Gläubiger und die Höhe der Einlagensummen von Banken und Fonds können die Zentralbanken direkt keinen Einfluß ausüben. Sie sind lediglich in der Lage, die Konditionen zu gestalten, zu denen diese Einlagen weiterverliehen werden dürfen.
So gilt es allgemein als unstrittig, dass ein niedriger Zins es Investoren in Sachanlagen erheblich erleichtert, Gläubiger für die Finanzierung ihrer Investitionen ausfindig zu machen, weil die prognostizierte Rendite dieser Projekte die Höhe der Verzinsung von Guthaben auf den Geldmärkten schneller übersteigt. Ebenso ist auch klar, dass ein höherer Zins keinesfalls die Spekulation auf den Finanzmärkten einhegen kann, da die möglichen Profite dort in der Regel sehr viel höher als der Zinssatz ausfallen werden.
Ein steigender Zins aber wirkt dagegen immer wie eine „Bremse“ für reale Investitionen, da damit logischerweise die Rentabilität möglicher Vorhaben verringert wird. Keineswegs bedeutet ein niedriger Zinssatz allerdings automatisch Inflation oder die Bildung spekulativer Blasen inklusive zweifelhafter Kredite oder gar in jedem Fall eine hohe Auslandsverschuldung.
Für einen Finanzinvestor trägt eine niedrigerer Zins im Gegenteil sogar zu einer Verringerung seines Verschuldungsrisikos bei, weil er bei gegebener Kapitalrendite weniger Fremdkapital aufnehmen muss, um ein bestimmtes Ziel seiner Eigenkapitalrendite erreichen zu können.
International gesehen müßte bei der Richtigkeit dieser Vorwürfe Japan nach über zehn Jahren Niedrigstzinsen seit Ende der 90er Jahre ein von irrsinniger Spekulation und Inflation schwer getroffenes und im Ausland hoch verschuldetes Land sein. Schließlich hatte ja die japanische Zentralbank jahrelang einen Zinssatz von 0 % und knapp darüber festgelegt. Doch stattdessen wetteiferte Japan mit China und Deutschland lange um den Titel des Exportweltmeisters und steht auch heute noch am Abgrund der Deflation.
Demnach muss die wesentlichste Frage zur Beurteilung der Niedrigzinspolitik der FED nach 2001 doch sein, warum in dieser Phase nicht mehr Geld in Sachinvestitionen als in bedenkliche Konsumentenkredite geflossen ist. Zum Teil kann man diese Frage mit der mangelhaften Finanzmarktregulierung beantworten, die zu unseriösen Kreditvergaben und zur massiven Weitergabe dieser spekulativen Finanzprodukte rund um den Globus führten.
Doch es gibt auch realwirtschaftliche Zusammenhänge, die entscheidend zur Klärung dieses Sachverhaltes beitragen, aber von den politischen und medialen Vertretern der Verursacher dieser Probleme bis heute rundweg geleugnet werden.
Es handelt sich dabei um die globalen Handelsungleichgewichte, aus denen die immer schwerwiegenderen Schuldverhältnisse zwischen den nationalen Volkswirtschaften hervorgingen. So konkurrierten die amerikanischen Anbieter auf den Weltmärkten mit Unternehmen aus Lohndumpingstaaten wie Deutschland und Ländern mit unterbewerteter Währung wie Japan, China und anderen Schwellenländern. Diese hielten nach diversen Krisen an einer Unterbewertung ihrer Währungen fest, da in der Welt seit dem Ende von Bretton-Woods keine Währungsordnung mehr vorhanden war.
Deren überlegene Wettbewerbsfähigkeit lenkte die kreditfinanzierte Konsumlust der amerikanischen Verbraucher auf Waren aus dem Ausland und verhinderte damit eine entsprechende Wirksamkeit der stimulierenden FED-Geldpolitik zur Auslastungs- steigerung des amerikanischen Kapitalstocks. So wurden Sachinvestitionen in den USA unattraktiver und die Nachfrage hauptsächlich ins Ausland umgeleitet.
Ohne diese entstandenen Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen wäre wahrscheinlich mehr in den Vereinigten Staaten investiert worden. Damit wäre auch die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass das Platzen der Immobilienpreisblase zumindest über bessere Arbeitseinkommen aufgrund eines produktiveren und größeren Kapitalstocks abgeschwächt worden wäre.
Weniger Kapitalexport aus den Gläubigerländern hätte auch dazu geführt, dass mehr faule Kredite in den USA verblieben wären und nicht in alle Welt verteilt worden wären.
Durch das gesamtwirtschaftliche Gürtel-enger-Schnallen einiger wichtiger Gläubigerländer wie Deutschland als Ergebnis einer durch Preisdumping herbeigeführten Verbesserung ihrer Weltmarktanteile bleiben den Schuldnerländern nur wenige Möglichkeiten ihre Defizite abzubauen. Nur durch eine Abwertung ihrer Währung oder eigenes Lohndumping im Rattenrennen der „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“ können diese Staaten ihre Schulden abbauen.
Sowohl in Japan als auch in Deutschland (als Teil der Eurozone) blieben die Steigerungen der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten hinter der Zielinflationsrate der jeweils zuständigen Zentralbank zurück, aus unterschiedlichen Gründen unterblieb auch die Korrektur durch eine Aufwertung der eigenen Währung.
Im Falle Japans wurde dieses Mißverhältnis zudem noch durch die Spekulation mit Währungen, dem sogenannten Carry Trade, verstärkt. Die notwendige Aufwertung des Yen unterblieb aufgrund der Auf- statt Abwertung der Währungen von Hochinflationsländern, die durch die Kreditnachfrage in den Niedriginflations- und Niedrigzinsstaaten jahrelang auf den Devisenmärkten unter Druck gesetzt wurden.
Deutschland hingegen konnte sich mit seiner De-facto-Unterbewertung quasi „hinter“ seinen Europartnerländern verstecken, die ja keine Lohndumpingstrategie verfolgten und dadurch mit ihren ständig steigenden Leistungsbilanzdefiziten für eine ausgeglichene Leistungsbilanz des Eurogebietes insgesamt sorgten.
Diese beiden Beispiele sind zudem auch der Beweis dafür, dass entgegen der neoklassischen These die Devisenmärkte auch selbst über lange Zeiträume nicht in der Lage sind, einen Ausgleich der internationalen Inflationsdifferenzen zu schaffen, ganz im Gegenteil verstärken sie diese noch.
Im zweiten Teil dieser kleinen Reihe wird es dann darum gehen, warum man solche grundlegenden Zusammenhänge nicht ausmachen kann, wenn man Handelsungleichgewichte als eine unvermeidliche und marktkonforme Konsequenz einer falschen Verschuldungspolitik durch Niedrigzinsen bzw. der nicht vorhandenen Sparbereitschaft der privaten Haushalte in den Defizitländern ansieht und auf die neoklassische These der langfristig ausgleichenden Selbstheilungskräfte durch die Devisenmärkte setzt.