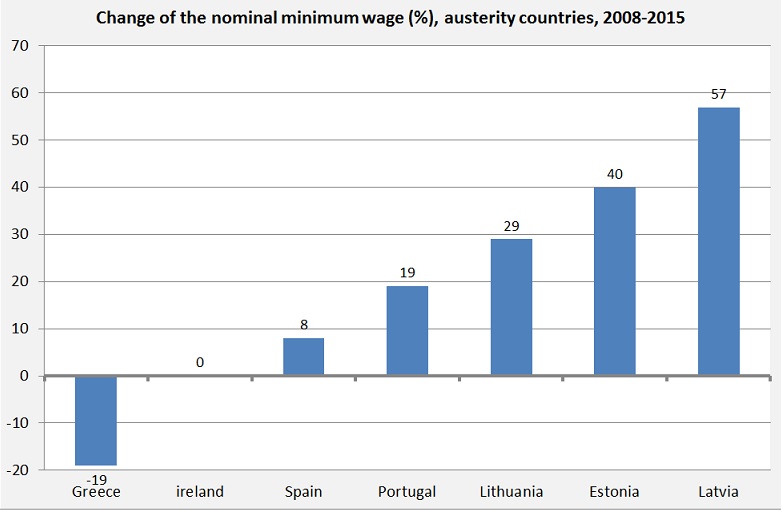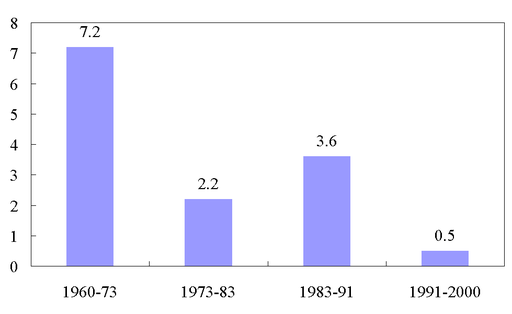In Teil 1 dieser Serie über die volkswirtschaftlichen Aufgaben der Gewerkschaften identifizierten wir anhand des Buches „Marktpreis und Menschenwürde“ von Wolfgang Stützel die Beschränkung der Individualkonkurrenz der Arbeitnehmer untereinander als eine fundamentale Basis ihrer ordnungspolitischen Legitimation.

Sicherlich waren es zunächst die Gesetzgeber, die mit entsprechenden Arbeitszeitregeln Schutzvorkehrungen gegen die Gnadenlosigkeit der unmenschlichen Unterbietungs- konkurrenz einrichteten. Doch nach der Ächtung der Möglichkeiten zum Mehrangebot an Arbeitszeit blieb es den konkurrierenden Arbeitnehmern jedoch selbst überlassen, etwas gegen die nächste Eskalationsstufe bei der Vermeidung der Erwerbslosigkeit zu unternehmen.