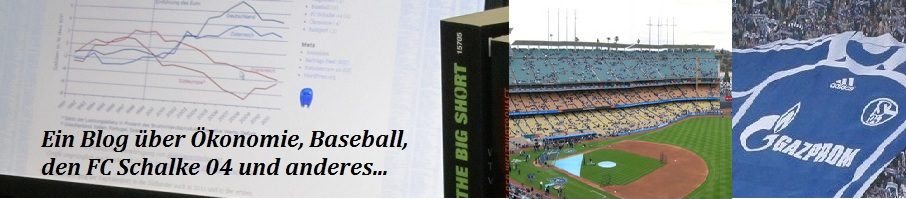Die Krise in Japan wurde 1990 ausgelöst, als eine Finanz- und Immobilienblase platzte. In den Jahren zuvor waren die Immobilienpreise sowie die Aktienkurse ins Unermessliche gestiegen. Das Land versank in einer Deflation, aus der es sich bis heute nicht richtig befreien konnte.
Es entstand der Begriff der „verlorenen Dekade“, Schlagwort für eine schwere makroökonomische Absatzkrise, die in dieser Form auch der Europäischen Union bevorstehen könnte.

Schon damals war es die konventionelle Gewissheit bei vielen Ökonomen, Notenbankern, Finanzjournalisten und Politikern, dass Japan „dringend benötigte Strukturreformen“ implementieren müsse, um die Krise überwinden zu können.
„Keine Erholung ohne Strukturreform“, verkündete der damalige Ministerpräsident Jun’ichirō Koizumi. Der Fall Japan wurde auch zum Vorbild ähnlicher Reformen in anderen Ländern und Regionen, wie zum Beispiel Deutschland, wo sie bald ebenfalls ein Schwerpunkt der Regierungspolitik wurden.
Angesichts dieses überwältigenden Konsens ist es verlockend anzunehmen, dass die Theorie der Struktur- reformen damals gründlichen empirischen Tests unterzogen und durch diese deutlich unterstützt wurde. Solche empirischen Überprüfungen hatte es bis dahin allerdings nicht gegeben. Erst der deutsche Ökonom Richard A. Werner lieferte 2004 ein solches Papier, mit dem die empirische Daten-Erfassung analysiert und die neoklassischen Theorien, auf denen die Idee der strukturellen Reformen beruhte, getestet wurden.
Er kam darin aber zu der überraschenden Feststellung, dass es keine tatsächlichen Argumente für die Strukturreformen gab. Angebotsseitige Faktoren waren nicht verantwortlich für die japanische Rezession. Eine alternative nachfrageseitige Erklärung, die sich vor allem auf die Kreditvergabe stützte, wurde dagegen durch die gefundenen Beweise gestützt.
In dieser Beitragsreihe soll nun ein näherer Blick auf diese Untersuchung geworfen werden, da auch heute noch „Strukturreformen“ als eine Art neoliberaler Allzweckwaffe gegen jedwede wirtschaftliche Probleme gesehen werden.
Teil 1: Einführung in die Problematik
Es war damals in Japan Mode geworden zu behaupten, dass die Regierung dringend benötigte Struktur- reformen umsetzen müsse. Die Financial Times zum Beispiel wiederholte diesen Anspruch mit auffälliger Regelmäßigkeit.
Vor dem Erreichen der Mainstream-Medien hatte nur eine Minderheit von Ökonomen und Notenbanker überhaupt Kenntnis von dieser Theorie. Neoklassische Ökonomen in den 1970er und 1980er Jahren argumentierten, dass nur auf freien und ungehinderten Märkten erfolgreich Wirtschaftswachstum produziert werden könne.
Hindernisse für das ungehinderte Wirken der Marktkräfte wie Regulierungen, Kartelle, Arbeitsmarkt-Gesetze zum Schutz von Mitarbeitern, beschränkter Einfluss der Aktionäre und Shareholder sowie im allgemeinen staatlicher Einfluss auf den Besitz und die Verwendung von Ressourcen wurden als ineffizient und als Grund für schwache Wirtschaftsleistungen angesehen.
Um nur ein paar repräsentative Beispiele zu nennen, argumentierte der japanische Ökonom Heizo Takenaka 1996 beispielsweise, dass die japanische Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre durch das System der staatlichen Interventionen in der Nachkriegszeit verursacht wurde und dass weitreichende Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung zu ihrer Überwindung nötig wären.
Kazuhito Ikeo (2001) argumentierte, dass die geringe Produktivität Grund für Japans Rezession gewesen sei und diese nur durch erhebliche strukturelle Veränderungen beendet werden könnte.
Nach Takeo Hoshi und Anil Kashyap (2000) waren es Ineffizienzen der Finanzmärkte, die das japanische Finanzsystem behinderten, auch sie hielten Deregulierungen und Strukturreformen der Finanzmärkte für erforderlich.
Seit den 1970ern hatte auch die Bank of Japan immer wieder strukturelle Reformen oder auch die strukturelle Transformation der japanischen Wirtschaft gefordert, um wieder auf einen Wachstumspfad zurückzukehren. Ohne Strukturreformen würde die Geldpolitik allein keine nachhaltige Aufwärtsentwicklung bewirken können, so die Argumentation der Zentralbanker.
Diese Behauptung gewann in den 1990er Jahren eine breitere Akzeptanz und wurde auch von der Mehrheit der Medien übernommen. Seitdem gilt diese These in der Presse nicht mehr als eine ungetestete Hypothese oder Theorie, sondern als eine erwiesene Tatsache.
Auch in Deutschland stimmten viele Ökonomen und Journalisten in diesen Chor ein. Die Regierung Schröder stand seinerzeit unter einem wahren Feuerwerk von Vorwürfen durch Zeitungen, Fernsehen und wirtschaftliche Veröffentlichungen, dass nur grundlegende Strukturreformen einen Aufschwung erzeugen könnten.
Die deutsche Wirtschaft werde stagnieren, so die Financial Times 2003, wenn sich das Land den neoklassischen Empfehlungen weiterhin verschließen sollte. Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung seien vonnöten, Staatsunternehmen zu verkaufen und der Arbeitsmarkt müsste flexibler werden.
Zur Unterstützung dieser Thesen, die Gerhard Schröder und sein Kabinett damals auf den direkten Weg zu Hartz IV und die Agenda 2010 leiten sollten, wurde beispielsweise behauptet, dass seit 1990 die angelsächsischen Volkswirtschaften USA und Großbritannien die europäischen Länder Deutschland, Frankreich, Italien und vor allem Japan wirtschaftlich überholt hätten.
Dies wäre der Beweis, dass der Manchester-Kapitalismus der Amerikaner und Briten mit freien Märkten, mehr Liberalisierung und Deregulierung den damals noch wohlfahrtskapitalistischen Staaten wie Deutschland und Japan überlegen sei.
Doch ist das wirklich so? Am Beispiel Japan soll hier gezeigt werden, ob die Politik der Strukturreformen tatsächlich funktionieren kann, immerhin handelt es sich dabei um eine der größten Volkswirtschaften der Welt und ein Land, in dem schon seit über dreißig Jahren lautstark für eine historische Strukturreform der Liberalisierung getrommelt wurde.
Anfang 2000 war die japanische Volkswirtschaft bereits seit einem Jahrzehnt in Schwierigkeiten. Der Einzelhandelsumsatz schrumpfte während dieser Zeit ebenso wie die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes. Sinkende oder nur wenig steigende Preise brachten jahrelange Disinflation und ab 1998 offene Deflation. Über 200.000 Unternehmen mussten Konkurs anmelden, die Arbeitslosigkeit steuerte Rekordzahlen an.
Auch der öffentliche Schuldenberg wuchs, und die Polizei meldete ca. 30.000 Selbstmorde pro Jahr, hauptsächlich verursacht durch Kündigungen, Firmenbankrotte und die ebenso ausufernde private Verschuldung.
Als erste Maßnahmen gegen die Krise griffen die diversen Regierungen zu Mitteln der Konjunkturpolitik. Zwischen 1991 und 2001 senkte die Zentralbank den kurzfristigen Zins von 6 Prozent bis auf unter 0,1 Prozent. Doch der erhoffte Aufschwung blieb aus.
Mehrere großangelegte Ankurbelungsprogramme führten ebenfalls nicht zum gewünschten Erfolg. Darüberhinaus blieb die Fiskalpolitik enorm stimulierend, doch sinkende Einnahmen aufgrund niedriger Steuersätze und erhöhte Staatsausgaben für die Arbeitslosenunterstützung und die soziale Sicherheit produzierten eine in der japanischen Nachkriegsgeschichte beispielslose Staatsverschuldung.
Doch die Wachstumsrate des BIPs ging trotzdem immer weiter zurück, stattdessen stellte man im Gegensatz zu den Lehrsätzen der neoliberalen Theorie fest, dass die Fiskalpolitik eher wenig Einfluss auf die private Nachfrage zu haben schien.
Auch Versuche, durch Wechselkurspolitik die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen, scheiterten. Trotz großangelegter Yen-Verkäufe durch die Zentralbank stieg die japanische Währung Ende der 1990er wieder an und ließ sich auch durch weitere Interventionen nicht daran hindern, bis 2003 auf 107 Y/$ zu klettern.
Angesichts dieser enttäuschenden Bilanz der traditionellen Zins-, Steuer- und Währungsinterventionspolitik zur Stimulierung der Nachfrage, stellten auch prominente ehemalige Unterstützer der Nachfragesteuerung fest: Die üblichen antizyklischen makroökonomischen Politikmaßnahmen hätten in Japan nicht gewirkt.
Und so trat eine Gruppe von Ökonomen in den Vordergrund, die behaupteten, das Problem Japans läge allein auf der Angebotsseite, die altmodische Wirtschaftsstruktur würde das Wachstum behindern.
Es gäbe zu viele Regierungsinterventionen, zu viel Gesetze und Regelungen, zu viele Kartelle, zu große Macht der Gewerkschaften und zu wenig Einfluss der Aktionäre und zu wenig Profitorientierung, alles Gründe, weshalb niedrige Produktivität, Strukturengpässe und Ineffizienz auf allen Ebenen den Wettbewerb dämpfen und die Entfaltung der Kräfte des freien Marktes verhindern würden.
Japan benötige daher ein radikales Programm der Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung. Die moderne neoklassische Volkswirtschaftslehre habe bewiesen, dass Strukturreformen weg vom traditionellen japanischen System und hin zum US-amerikanischen System der heimischen Wirtschaft helfen würden.
Dieses Argument wurde so oft wiederholt, dass man gerne bereit ist zu glauben, die These der bitter nötigen Strukturreform sei bestens belegt und bewiesen. Leider ist dem nicht so. Es ist daher gerade für Mitteleuropäer auch heute von großer Bedeutung, die Tatsachen zu überprüfen, denn nur wenn Beweise dieses weitverbreitete Argument untermauern, sollte man auch politische Initativen daraufhin durchführen.
Im zweiten Teil dieser Reihe geht es dann um die empirische Überprüfung, ob es tatsächlich Beweise für die Wirksamkeit von Strukturreformen gibt. Anhand der neoklassischen Wachstumstheorie und der Effizienztheorie soll dieser Ansatz näher beleuchtet werden.