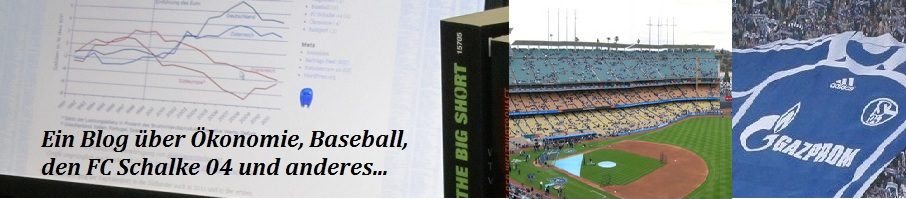„Money can’t buy me love (Geld kann mir keine Liebe kaufen)“, sangen die Beatles früher einmal, obwohl es zweifelhaft erscheint, dass dies wirklich ein strenger empirischer Anspruch war.

Paul McCartney, George Harrison und John Lennon performen
„Can’t buy me love“ (1964)
Dennoch bestreitet niemand, dass es mehr im Leben gibt als Geld und ein neues Buch, The Origins of Happiness argumentiert, dass Glück und Zufriedenheit ein Leitfaden für die Regierungspolitik sein sollten.
Vor zwei Jahren wäre das ein Teil des Zeitgeistes gewesen: Einer von Barack Obamas leitenden Beratern, der Ökonom Alan Krueger, war ein bekannter Experte für „subjektives Wohlergehen“ (Glück für Sie und mich), während sich der frühere britische Premier-minister David Cameron ebenfalls für diese Idee einsetzte.
Es scheint jedoch heute seltsamerweise nicht mehr in die Zeit zu passen: Was auch immer Sie meinen mögen, was Großbritanniens derzeitige Ministerpräsidentin Theresa May oder den US-Präsidenten Donald Trump antreibt, es erscheint unwahrscheinlich, dass dies eine Erhebung der Lebenszufriedenheit ist.
Dennoch ist es immer noch einfach, mit Thomas Jeffersons Bemerkung zu sympathisieren, kurz nachdem er als US-Präsident zurückgetreten war: „Die Sorge für das menschliche Leben und Glück, und nicht ihre Zerstörung, ist das erste und einzige legitime Objekt einer guten Regierung.“
Die Frage ist, was das für die Regierungspolitik bedeutet – und ob das akademische Studium des Wohlbefindens dabei helfen kann. Die fünf Autoren von The Origins of Happiness, darunter Professor Richard Layard von der London School of Economics, konzentrieren sich auf einer Skala von 0-10 auf Antworten auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie heute insgesamt mit Ihrem Leben?“.
Es ist keine absurde Frage, aber wenn eine Gruppe von Akademikern vorschlägt, die wirtschaftlichen Institutionen und die industrielle Strategie eines Landes auf der Grundlage von Antworten auf Fragen wie diese zu reformieren: „Wie reich sind Sie insgesamt in diesen Tagen auf einer Skala von 0-10?“, könnten wir vernünftigerweise einwenden, dass unsere Evidenzbasis zu unscharf sei, um eine wirkliche Orientierung zu bieten.
Es ist auch nicht klar, ob jemand, der auf der Skala von drei auf vier wechselt, den gleichen Glücksschub genießt wie jemand, der von sieben auf acht wechselt. Und was bedeutet „10“ wirklich? Ist es buchstäblich unmöglich, von dort noch glücklicher zu werden – oder sollte es nicht doch Platz bis zur „11“ geben?
Diese Fragen könnten vielleicht tatsächlich nur die Philosophen beunruhigen, doch Lord Layard und seine Mitautoren schreiben von einer „Revolution in der Politikgestaltung“, basierend auf Erkenntnissen wie „ein zusätzliches Jahr der Bildung erhöht direkt dein eigenes Glück um durchschnittlich 0,03 Punkte im Laufe des Lebens“. Dies deutet auf eine sehr selbstbewusste politische Analyse hin, der ich allerdings so nicht ganz folgen kann.
Dennoch ist ein wenig Einsicht besser als gar keine, und es wäre fahrlässig zu ignorieren, was die Leute uns darüber sagen, wie sie sich fühlen. Also, was lernen wir daraus?
Erstens haben wir eine Art Hassliebe zu unseren Jobs. Wir wissen aus Paneldaten (die gleichen Leute werden mehr als einmal interviewt), dass Arbeitslosigkeit unglücklich macht und dies über viele Jahre hinweg auch so bleibt. Dies ist ein gutes Argument für Maßnahmen, die eine niedrige Erwerbslosigkeit fördern – etwas, das Japan, Deutschland, Großbritannien und die USA geschafft haben, und Frankreich, Italien und Spanien eben nicht.
Doch auch wenn die Arbeitslosigkeit deprimierend erscheint, ist selbst die Arbeit an sich kein Paradies. Selbstständige sind im gleichen Maße glücklicher als Erwerbstätige wie Arbeitslose unglücklicher sind. Und Alan Krueger sowie der Nobelpreisträger und Psychologe Daniel Kahneman haben gezeigt, dass von all den alltäglichen Aktivitäten, die wir machen, das Pendeln zum Job und die Arbeit an sich am wenigsten Spaß machen – während von all den Leuten, mit denen wir Zeit verbringen, die Kollegen als schlecht und die Chefs als noch viel schlimmer wahrgenommen werden.
Die Antwort auf diese Probleme sind natürlich mehr und bessere Jobs. Und es scheint, dass auch mehr Zeit für die Befriedigung romantischer Beziehungen helfen würde – doch dabei ziehe ich es vor, die Regierung draußen zu lassen.
Lord Layard und seine Kollegen argumentieren im Allgemeinen für die Bewertung der Staatsausgaben unter Verwendung einer „Methode der Kosteneffizienz, bei der die Vorteile in Einheiten des Glücks gemessen werden“. Einige Richtlinien – wie die Lieferung von Fertigbetonböden für arme Haushalte in Mexiko – bestehen diesen Test problemlos. Andere nicht.
Lord Layard ist seit langem ein Verfechter von mehr Ressourcen für die Behandlung von Depressionen und Angstzuständen. Er hat recht damit. Selbst eine bescheidene Erfolgsrate würde hier einen langen Anlauf rechtfertigen. Doch darüber hinaus hängt viel von den Fähigkeiten einer Regierung ab, das Richtige zu liefern. Bessere Schulen, so heißt es, verbessern das emotionale Wohlbefinden von Kindern, was eine ausgezeichnete Investition fürs Glücklichsein darstellt. Gut, aber niemand ist für schlechtere Schulen, und die Forscher geben zu, wenig darüber zu wissen, welche Merkmale einer Schule mit glücklichen Schülern zusammenhängen.
Es gibt viel an der Idee einer aktivistischen Glückspolitik um jeden mit Laissez-faire-Instinkten zu unterhalten oder aber auch zu erschrecken. Doch in dem Maße, in dem wir der Ansicht sind, dass Regierungen manchmal einen Weg zur Verbesserung der menschlichen Situation einschlagen sollten, wäre auch zu prüfen, was die Leute uns darüber mitteilen, wie sie mit ihrem Leben glücklich sind.
Als Vorsichtsmaßnahme biete ich jedoch Adam Smiths Warnung vor derjenigen Person an, die „sich vorzustellen scheint, dass er die verschiedenen Mitglieder einer großen Gesellschaft mit so viel Leichtigkeit arrangieren kann, wie seine Hand dies mit den verschiedenen Figuren auf einem Schachbrett tut“. Ob ein Politiker nun versucht, das Nationaleinkommen oder aber das Nationalglück zu maximieren, Smiths Kritik klingt in etwa gleich zutreffend.
(Eigene Übersetzung eines Blogbeitrages des britischen Ökonomen Tim Harford)