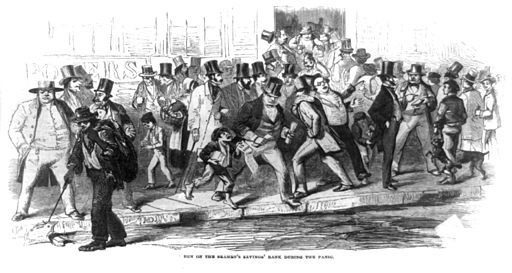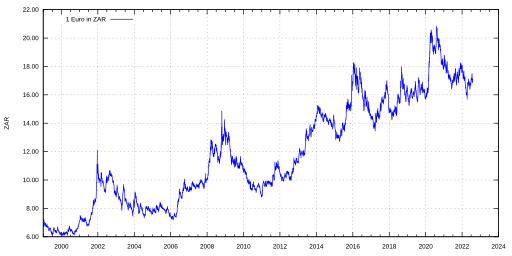Die Krise in Japan wurde 1990 ausgelöst, als eine Finanz- und Immobilienblase platzte. In den Jahren zuvor waren die Immobilienpreise sowie die Aktienkurse ins Unermessliche gestiegen. Das Land versank in einer Deflation, aus der es sich bis heute nicht richtig befreien konnte.
Es entstand der Begriff der „verlorenen Dekade“, Schlagwort für eine schwere makroökonomische Absatzkrise, die in dieser Form auch der Europäischen Union bevorstehen könnte.

Schon damals war es die konventionelle Gewissheit bei vielen Ökonomen, Notenbankern, Finanzjournalisten und Politikern, dass Japan „dringend benötigte Strukturreformen“ implementieren müsse, um die Krise überwinden zu können.
„Keine Erholung ohne Strukturreform“, verkündete der damalige Ministerpräsident Jun’ichirō Koizumi. Der Fall Japan wurde auch zum Vorbild ähnlicher Reformen in anderen Ländern und Regionen, wie zum Beispiel Deutschland, wo sie bald ebenfalls ein Schwerpunkt der Regierungspolitik wurden.
Angesichts dieses überwältigenden Konsens ist es verlockend anzunehmen, dass die Theorie der Struktur- reformen damals gründlichen empirischen Tests unterzogen und durch diese deutlich unterstützt wurde. Solche empirischen Überprüfungen hatte es bis dahin allerdings nicht gegeben. Erst der deutsche Ökonom Richard A. Werner lieferte 2004 ein solches Papier, mit dem die empirische Daten-Erfassung analysiert und die neoklassischen Theorien, auf denen die Idee der strukturellen Reformen beruhte, getestet wurden.