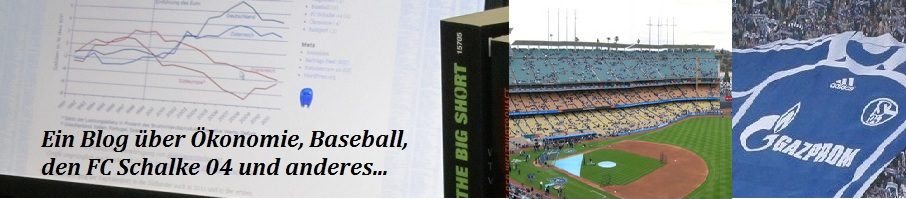In meinem letzten Beitrag zur Saldenmechanik, in dem es um die Frage nach der Moral ging, habe ich neben der allgemeinen Ursachenforschung mittels wirtschaftstheoretischer Modell-Analysen bereits kurz die „Schuldfrage“ bei Kreditverhältnissen aus einzelwirtschaftlicher Sicht angeschnitten.

Allgemein gilt nun mal der Grundsatz als gegeben, dass vor allem der Schuldner erstmal „schuld“ ist, wenn es in der Beziehung zwischen Gläubiger und Kreditnehmer irgendwie hakt.
Schließlich hätte er den Kredit ja nicht aufnehmen müssen. Schließlich hat er doch über seinen Verhältnissen gelebt. Und wenn wir irgend etwas aus der Eurokrise gelernt haben, dann ja wohl diese Schuldzuweisung. Immer wieder haben uns die Politiker verschiedener Couleur doch genau diesen einfachen Sachverhalt klarmachen wollen: Der Schuldner ist schuld!
Unterschiede einzel- und volkswirtschaftlicher Verschuldung
Doch wie sieht diese Problematik eigentlich volkswirtschaftlich, d. h. im Verhältnis zwischen Staaten aus? Kann man da auch so einfach festhalten, dass der verschuldete Staat „schuld“ ist und das Gläubiger-Land generell im Recht ist?
Einzelwirtschaftlich (mikroökonomisch) ist es durchaus plausibel und auch oft zutreffend, dass, wer über seinen Verhältnissen gelebt hat, auch „schuld“ an seinen Schulden ist.
Dies kann für einzelne Personen, Familien oder auch einzelne Unternehmen häufig angenommen werden, wenn über einen längeren Zeitraum die Höhe der Ausgaben die der Einnahmen überschreitet. Es muss allerdings nicht immer gelten, dass derjenige, der diese Schulden aufgenommen hat, auch tatsächlich daran „schuld“ sein muss. Es gibt sicherlich viele Gründe wie z. B. Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder andere persönliche Unglücksfälle, bei denen man nicht unbedingt den Schuldner als alleinigen Verursacher der Verschuldung ausmachen kann.
Doch in allen anderen Fällen, in denen die Assoziation des Begriffes „über den Verhältnissen zu leben“ zutreffend ist, gilt tatsächlich erst mal die Gleichsetzung von „Schulden haben“ und „schuld sein“. Daher spricht dann auch vieles dafür, dass derjenige, der sich stark verschuldet hat und am Markt keinen Kredit mehr bekommt, sanktioniert werden muss.
Gesamtwirtschaftlich sieht das allerdings, vor allem bei der Verschuldung von Staaten untereinander, ganz anders aus.
Da ist das, was gemeinhin als „zu hoch verschuldet“ bezeichnet wird, vor allem das Ergebnis der Saldenbildung von unzähligen unabhängig voneinander handelnden Einzelakteuren und Unternehmen, die sich bemühen, in ihrem eigenen Sinne „wirtschaftlich“ zu handeln und ihren Konsum entsprechend den gegebenen Rahmenbedingungen auszusteuern.
So kann bedingt durch diesen Rahmen über die Zeit und als Folge anonymen Handelns Einzelner der Staat als Ganzes zum Schuldner werden, obwohl innerhalb der volkswirtschaftlichen Sektoren überwiegend verantwortungsbewußt gehandelt wird.
Besteht dann zwischen den beteiligten Staaten eine Währungsunion, in der sich die Länder auf eine gemeinsame von allen einzuhaltende Inflationsrate geeinigt haben und der Gläubigerstaat sich an diese über einen längeren Zeitraum nicht gehalten hat, so ist eine einseitige Schuldzuweisung an die sich aufgrund dieser Rahmenbedingungen verschuldeten Staaten nicht wirklich gerechtfertigt.
Gibt es einen „Zwang“ zur Kreditaufnahme?
Auch Wolfgang Stützel hatte sich bereits in seinem Buch „Volkswirtschaftliche Saldenmechanik“ mit der Thematik beschäftigt, inwieweit man in bestimmten Fällen aufgrund gegebener Rahmenbedingungen durchaus von einem „Zwang“ zur Geldvermögensänderung bzw. Kreditaufnahme reden kann.
Dabei kommt er zu dem Schluß, dass es vor allem die Art und Weise der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen ist, die darüber entscheidet, ob und wie der Gezwungene tatsächlich handelt.
Gelingt demjenigen, der in der Lage ist, die Rahmenbedingungen allein zu setzen, diese so festzulegen, dass seinem Partner gerade durch die freie Maximierung seiner „Nutzenfunktion“ im Prinzip keine andere Möglichkeit als die vorgegebene mehr wirtschaftlich erscheint, so kann man durchaus von einem gewissen „Zwang“ ausgehen.
So schrieb Stützel auf Seite 99:
Ob man nun sagt, A locke den B mit dem „Zuckerbrot“ der Gewinndifferenz zwischen M und M‘, die erste statt der zweiten Möglichkeit zu verwirklichen, oder ob man sagt, A drohe mit der „Peitsche“ des Gewinnentgangs, falls B die Möglichkeit M‘ an Stelle von M verwirklicht, ist lediglich eine andere Ausdrucksweise.
Stets ist der „Zwang“, den A auf B ausübt, nur das Spiegelbild des Gewinnmaximierungsstrebens des B selbst, das ihn nämlich, nachdem A die Rahmenbedingung setzte, veranlaßt, M an Stelle von M‘ zu verwirklichen.
Zwang zur Kreditaufnahme als Folge des Gewinnstrebens
Aus den Erörterungen Stützels kann man weiter entnehmen, dass zwar einzelne Wirtschaftssubjekte selbstverständlich im Einzelfall selbst entscheiden, ob und in welcher Höhe sie Kredite aufnehmen.
Das aber schließe nicht aus, dieses Verhalten als „erzwungen“ anzusehen, da es nicht ungewöhnlich sei, dass sich die Gezwungenen selbst frei entscheiden, etwas zu tun, was andere ihnen „aufzwingen“.
Es ist wie bereits weiter oben erwähnt immer auch eine Frage der gesetzten Rahmenbedingungen, aufgrund derer Wirtschaftssubjekte sich, um ihre Ziele zu erreichen anders verhalten (z. B. mehr Kredit aufnehmen müssen), als sie eigentlich müßten, wenn diese Rahmenbedingungen nicht so gesetzt wären.
Wirtschaftswissenschaftlich betrachtet handelt es sich dabei um die Bestimmung des Maßes des Zwangs, Kredit aufzunehmen.
Dieser ist bei jedem einzelnen Subjekt gleich der Differenz zwischen dem Nutzen der verbleibenden maximalen Möglichkeit, durch Kreditaufnahme den Status Quo zu erhalten und dem Nutzen der alternativen Möglichkeit, ohne Kreditaufnahme eine Geldvermögensminderung und damit auch eine Einschränkung von Umsätzen und Gewinn hinnehmen zu müssen.
Der entscheidende Maßstab, ob man nun bei der Kreditaufnahme von einem „freiwilligen“ Liquiditätsstrebens des fraglichen Wirtschaftssubjekts oder aber von einem „Zwang“ zur Darlehensaufnahme ausgeht, ist dabei die Rigidität der gesetzten Rahmenbedingungen.
Je unveränderbarer (weil z. B. von außen festgelegt) eine Rahmenbedingung gesetzt ist, desto eher muss man diese als ursächliche Variable ansehen, die nicht in einer Wechselwirkung mit anderen veränderbaren Variablen (=anderen Erklärungsansätzen) steht, sondern unabhängig und damit weitestgehend tatsächlich „aktiv“ und nicht resultierend ist.
Diese Bedingung gilt übrigens sowohl bei der einzelwirtschaftlichen als auch bei der Betrachtung von mehrstufigen Gefügen (= Gesamtheit der Wirtschaftssubjekte). Damit ist dieser Erklärungsansatz auch auf das Verhältnis der einzelnen Sektoren (Private, Unternehmen, Staat und Ausland) in der Gesamtwirtschaft anwendbar.
Gesamtwirtschaftliche Anwendung dieser Methodik auf die Eurokrise
Wendet man nun diese Art der Ursachenforschung auf die Bedingungen an, die letztlich zur Eurokrise geführt haben, so muss man die nicht von allen eingehaltene gleiche Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine unterschiedliche Anpassung der Lohnstückkosten an die Inflationsrate als gesetzte Rahmenbedingung ansehen.
Die Krisenstaaten hatten letzlich keinen Einfluß auf die Lohnentwicklungen in den anderen Ländern, gleichzeitig konnten sie durchaus erwarten, dass sich alle EU-Mitgliedsstaaten an die mit der EZB vereinbarten Entwicklung der gemeinsamen Zielinflationsrate halten würden, und diese nicht durch einseitiges Lohndumping auf Dauer unterschreiten würden.
Damit wird dann aber auch klar, dass diese Staaten als Teilsektoren der jeweiligen Gesamtwirtschaften gar keine anderen Möglichkeiten hatten, als die negativen Leistungsbilanzsalden hinzunehmen und dadurch zur Schuldenaufnahme zwecks Entlastung der privaten Sektoren in obigem Sinne „gezwungen“ wurden, um den ökonomischen Status Quo ihrer Gesellschaften möglichst zu erhalten.
Daher ist es auch auf diesem Wege wie bereits weiter oben ebenfalls festgestellt durch nichts gerechtfertigt, diesen Staaten einseitig die „Schuld“ für des Entstehen der Krise zuzuweisen.
Tut man dies doch, so verläßt man damit die Grundlage einer wertfreien gesamtwirtschaftlichen Analyse und verliert sich in der Beliebigkeit moralischer, oft ideologisch geprägter Werturteile einzelwirtschaftlicher Prägung, wie sie in der Beurteilung der Eurokrise bisher leider viel zu oft vorgekommen sind.