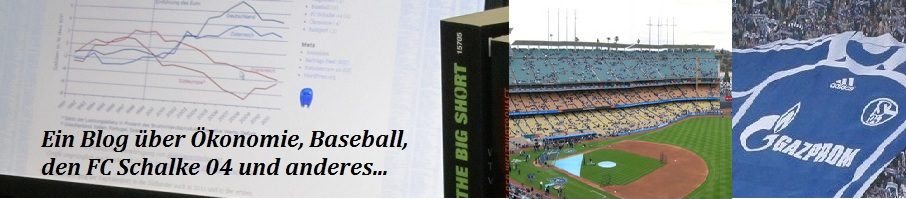Wie schlecht es der Eurozone geht, wird in der Regel zuerst mit Bezug auf Griechenland, dann Spanien, dann Italien und Portugal illustriert, den schwächsten Gliedern in der Kette der Mitgliedstaaten. Ganz zu schweigen von Zypern, Finnland und einigen mehr.

Logo des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)
Doch es gibt noch eine andere Art, die gleiche Fragestellung zu betrachten, indem man sich auf das vermeintlich stärkste Land in der Währungsunion konzentriert – Deutschland. Ein neuer Bericht des DIW Berlin (freigegeben am 5. Juli 2017) – „Einkommensschichten und Erwerbsformen seit 1995“, der nur in deutscher Sprache verfügbar ist, erzählt eine düstere, wenn nicht gar trostlose Geschichte darüber, was in dem angeblichen Powerhouse der Eurozone in den letzten 18 Jahren geschehen ist.
Es zeigt sich, dass das deutsche Modell nicht nur für den Rest der Mitgliedstaaten ungeeignet ist, sondern auch keine vernünftigen Ergebnisse für seine eigenen Bürger erzeugt – genauer für diejenigen der Unter- und Mittelschicht.
Einzelheiten und mehrere Begründungen, warum der deutsche Ansatz kein geeignetes Wirtschaftsmodell darstellt, gibt es hier:
1. Das deutsche Modell ist für die Eurozone nicht brauchbar.
2. Deutschland ist kein Vorbild für Europa – es scheitert im Ausland und zu Hause.
3. Die deutschen Handelsbilanzüberschüsse zeigen das Versagen der Eurozone.
4. Deutschland sollte sich lieber selbst im Spiegel betrachten.
Die jüngsten Forschungen des DIW Berlin (wie oben zitiert) liefern noch mehr Beweise, die diese Position unterstützen. Die DIW-Ergebnisse halten fest, dass:
Die Verteilung der verfügbaren Einkommen und die Arten der Beschäftigung haben sich in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verändert.
Ihre Forschung versucht dabei, diese Entwicklung seit 1995 genauer zu durchleuchten. Die Studie verwendete das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), einen repräsentativen mikroanalytischen Datensatz für Deutschland, der jährlich seit 1984 (West) und seit 1990 für das vereinigte Deutschland aufgezeichnet wurde.
Dabei handelt es sich um eine exzellente Zusammenstellung von Daten, die auch bei der Untersuchung der Auswirkungen der Hartz-Reformen in Deutschland eingesetzt wurde.
Hauptaugenmerk der Studie lag auf der Einkommensverteilung in Bezug auf die Anzahl der Personen mit niedrigen, mittleren und hohen Einkommen. Dazu setzte das DIW diese Kategorien relativ zum Median der Bevölkerung und definierte eine Armutsrisikoschwelle bei 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens der Gesamtbevölkerung.
Sie fanden dabei folgendes heraus:
1. Der Anteil der Arbeitnehmer in der Bevölkerung, die als „armutsbedroht“ eingestuft wurden, ist gestiegen. Die Zahl der Menschen in schwerwiegender Armut (weniger als 46 Prozent des Medianeinkommens) ist seit Ende der 90er Jahre deutlich gestiegen.
2. Der Anteil der Beschäftigten mit hohem Einkommen ist gestiegen.
3. Niedrig bezahlte Beschäftigung liegt jetzt höher als vor 20 Jahren. Der Anteil der Beschäftigten mit niedrigem Einkommen ist von 24,4 Prozent auf 33,7 Prozent gestiegen und der Anteil der Niedriglohnarbeiter nahm von 16,7 Prozent auf 24,5 Prozent zu. Der Anteil der Niedriglohnarbeiter ist seit 2007 relativ stabil geblieben.
Die Hartz-Reformen, die im Jahr 2003 begannen, beschleunigten die Aufspaltung des Arbeitsmarktes und der Anteil prekärer Arbeit erhöhte sich. Hartz II hatte neue Beschäftigungsformen eingeführt, den „Mini-Job“ und den „Midi-Job“ und es gab als Folge einen starken Rückgang der regulären Beschäftigung.
Mini-Arbeitsplätze bieten eine marginale Beschäftigung ohne Sicherheit oder sonstige Ansprüche und erlauben es den Arbeitnehmern, bis zu 450 Euro pro Monat steuerfrei zu verdienen, während die Kosten für die Arbeitgeber deutlich niedriger sind. Die Steuerfreiheit bedeutet zudem auch, dass der Arbeitnehmer keinen Sozialversicherungs-schutz oder Rentenansprüche hat.
Die neoliberale Interpretation dieser Veränderungen stellt dies so dar, dass Deutschland ein wahres „Jobwunder“ erlebt habe. Der rasche Beschäftigungsanstieg kann aber auch weniger optimistisch betrachtet werden.
Die unten folgende Grafik zeigt die Geschichte der Mini-Jobs seit 2003. Im Juni 2017 gab es 7,4 Millionen „Miniprogramme“, die rund 16 Prozent der Erwerbsbevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren ausmachten. Wie die DIW-Studie festgestellt hat, ist dieser Anteil seit Ende 2007 nach einem raschen Anstieg der früheren Jahre des Programms ziemlich stabil.
Die rasche Zunahme der Mini-Jobs bedeutete für einen zunehmenden (und beträchtlichen) Anteil der deutschen Belegschaft, dass sie dazu gezwungen wurden, in prekären Arbeitsverhältnissen mit extrem niedrigen Löhnen zu arbeiten, und gleichzeitig auch noch davon abgehalten wurden, die Vorteile des nationalen Einkommenswachstums und die Chance, Rentenansprüche zu akkumulieren wahrzunehmen.

4. Das DIW hat auch festgestellt, dass in den höheren Einkommenskategorien mehr Menschen reguläre Vollzeit-Arbeitsplätze haben.
5. Trotz des Anstiegs der Beschäftigung ist die Einkommensungleichheit höher als vor 20 Jahren, wobei die Hauptverschiebungen zwischen 1995 und 2005 stattfanden.
6. Der Anteil derjenigen mit mittleren Einkommen (gruppiert zwischen 77 Prozent und 130 Prozent des Medians) ist in den zwei Jahrzehnten um 6 Prozentpunkte gesunken (von 47,8 Prozent auf 41,4 Prozent).
7. Es gibt jetzt mehr Menschen (29 Prozent) mit Einkommen unter 77 Prozent des Medians. 1995 betrug dieser Anteil 25%.
8. Der Anteil derjenigen mit über 169 Prozent des Medians ist von 12 auf 14 Prozent gestiegen.
9. Die Erwerbsbeteiligung ist seit 1995 deutlich gewachsen, vor allem bei Frauen und älteren Menschen.
10. Die üblichen Arbeitsbedingungen haben zunehmend dem, was als atypische Beschäftigung bezeichnet wird (Minijobs usw.) Platz gemacht.
Diese Verschiebungen beinhalten eine Zunahme der Arbeitnehmer, die weniger als 15 Stunden pro Woche beschäftigt sind, einen Anstieg der befristeten Arbeitsplätze, eine Zunahme der Selbstständigen und einen Anstieg aller sonstigen Formen der Nicht-Standard- (Niedriglohn-) Beschäftigung. Zusammengenommen zeigen diese Trends eine abnehmende Qualität der Arbeit in Bezug auf die Sicherheit der Anstellung, der Fähigkeit, höhere Lohn- und Schutzbedingungen zu erlangen, sowie der Möglichkeit, am Arbeitsplatz Diskretion und Vertraulichkeit zu bekommen.
Das DIW folgert daraus:
Insgesamt machen diese Entwicklungen deutlich, dass der erfreuliche Beschäftigungsanstieg der vergangenen Jahre nicht alle gleich erreicht hat und alleine nicht ausreichen dürfte, um allen in der Gesellschaft Wohlstand und Teilhabe zu ermöglichen.
Bei der Ermittlung des Anstiegs der Einkommensungleichheit produzierten sie die unten folgende Tabelle 1.
Der Gini-Koeffizient ist ein Maß für die Ungleichheit (höhere Werte zeigen aufsteigende Ungleichheit). Ein Gini von 1 bedeutet, dass eine Person alle Einkommen besitzt, während 0 eine gleichmäßige Einkommensverteilung anzeigt.
Wir beobachten, dass der Gini-Koeffizient insgesamt von durchschnittlich 0,25 zwischen 1995 und 1999 auf 0,29 zwischen 2014-15 gestiegen ist. Das ist ein rechtgroßer Sprung. Wir sollten diese Figur in den richtigen Kontext stellen. Die USA haben einen Gini-Koeffizienten von 0,46. Großbritannien 0,33, Australien 0,35, Frankreich 0,33, Italien 0,35.
Das andere Interessante an Tabelle 1 ist, dass die Umverteilungseffekte des Steuer- und Transfersystems in Deutschland eine wesentliche Rolle bei der Verringerung der Ungleichheit spielen, diese Effekte sich allerdings im Laufe der Zeit reduziert haben.
Doch der Bericht stellt auch fest, dass die steigende Einkommensungleichheit nicht auf signifikante Veränderungen im Steuer- und Transfersystem zurückzuführen ist, sondern eher auf tiefgreifende Veränderungen am Arbeitsmarkt.

Diese tiefgreifenden Arbeitsmarktveränderungen beinhalten:
1. Die Beschäftigungsquote (Beschäftigung als Prozentsatz der Erwerbsbevölkerung) der 25- bis 64-Jährigen ist zwischen den Jahren 1995-99 und 2014-15 kontinuierlich von fast 70 Prozent auf etwa 80 Prozent gestiegen.
2. Bei den Männern ist die Quote von 79 Prozent auf 84 Prozent gestiegen.
3. Für Frauen ist die Quote erheblich von 57 Prozent auf 73 Prozent gestiegen.
4. Ein weiteres Merkmal ist die steigende Beschäftigungsquote für ältere Arbeitnehmer – für die Altersgruppe zwischen 55 und 64 Jahren ist sie zwischen 1995 und 2015 von 41 auf 64 Prozent gestiegen.
Ebenso interessant ist die Tabelle 4 im DIW-Bericht. Sie zeigt den Anteil der Menschen, die nach drei Jahren in ihrem derzeitigen Arbeitsform geblieben sind oder in andere gewechselt haben (in Prozent).
So waren zum Beispiel im Zeitraum 1995-1999 80,5 Prozent der Arbeiter, die 1995 in regelmäßiger Beschäftigung waren, auch 1999 noch in dieser Erwerbsform, während im letzten Zeitraum 2010-2013 dieser Anteil auf 83,9 Prozent gestiegen war.
Der Anteil der Arbeitnehmer, die in aytpischen Arbeitsverhältnissen feststeckten, stieg dagegen während des gesamten Zeitraums dramatisch an. Im Jahr 1995 blieben 49,6 Prozent dieser Arbeitnehmer in dieser Kategorie bis 1999. Doch 2010 waren es schon 55,9 Prozent, die bis 2013 in dieser Erwerbsform verblieben. Im Laufe des gesamten Zeitraums fielen somit die Chancen eines aytpischen Arbeiters, wieder in eine reguläre Beschäftigung überzugehen, leicht zurück.
Es gab auch eine gewisse Trägheit unter den Arbeitslosen. Früher verblieben 39,8 Prozent der erwerbslosen Arbeitnehmer drei Jahren in diesem Zustand. Bis 2010-13 war dieser Anteil auf 46,1 Prozent gestiegen und die Chancen, die Arbeitslosigkeit durch eine reguläre Beschäftigung zu verlassen, waren insgesamt gesunken. Dagegen wurde es wahrscheinlicher, dass ein Arbeitsloser mit einem atypischen Job (wie z. B. einem Mini-Job) wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen konnte.

Schlussfolgerungen:
Insgesamt zeigt die DIW-Studie, dass Deutschland durchaus in der Lage war, seine Gesamtbeschäftigungsquote zu erweitern (so dass die Beschäftigung schneller gewachsen ist als die zugrunde liegende Bevölkerung), dagegen aber die Arbeitsqualität gesunken und die Einkommensungleichheit gestiegen ist. Darüber hinaus ist das Vorkommen von Armut und schwerwiegender Not stark angestiegen.
Es gab zudem einen konzertierten Angriff auf die deutsche „Mittelschicht“, da die Verteilung der Arbeitsplätze polarisiert wurde. Weniger Menschen genießen jetzt die Vorteile und die Sicherheit einer regulären Beschäftigung. Mehr Deutsche sind dafür nun anfälliger für prekäre Beschäftigung, Einkommens-unsicherheit und besonders Familien mit nur einem Einkommen sind einem viel höheren Armutsrisiko ausgesetzt.
Das sieht nicht wirklich wie eine richtige Erfolgsgeschichte aus. Und mittlerweile finden deutsche Kapitalisten zunehmend Wege, die osteuropäischen Arbeitsmärkte zu erobern, um damit den Angriff auf die Arbeits- und Lebensstandards in Deutschland noch zu beschleunigen.
Der skrupellose Herrscher hat seinen eigenen Leuten tatsächlich ein House of Cards gebaut. Echt verrückt.
(Eigene Übersetzung eines Blogbeitrages des australischen Ökonomen Bill Mitchell)