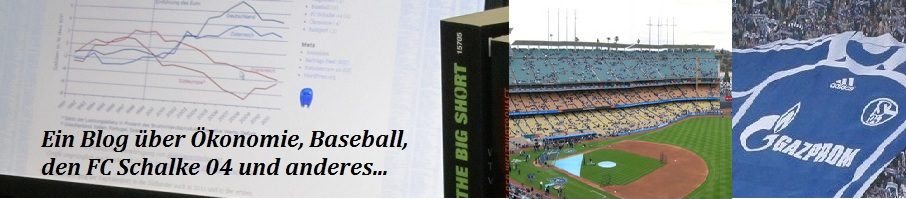Simon Wren-Lewis bloggte letztens zunehmend desillusioniert und verzweifelt über den desolaten Zustand der Finanzpolitik der Eurozone:

Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt
Nördliche Kernländer wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande verfolgen Null-Defizite oder gar Leistungsbilanzüberschüsse zu einem Zeitpunkt, an dem sich die EZB-Zinssätze an der effektiven Untergrenze bewegen, während die Kerninflation hartnäckig weit unter ihrem 2-Prozent-Ziel liegt. Man muss daher seiner Position in ihrer Gesamtheit zustimmen und eigentlich nur noch ein paar Anmerkungen hinzuzufügen.
Eine straffe Fiskalpolitik wäre an sich kein Problem, wenn eine unkonventionelle Geldpolitik (der Kauf von Staats- und Privatvermögen im Falle der EZB) ein perfekter Ersatz für eine antizyklische Fiskalpolitik darstellen würde. Doch dies ist eine Minderheitsposition in der ökonomischen und politischen Community. Und die Nordländer empfinden so etwas als instinkt- und geschmacklos, sehen sie es doch nahe daran, das Tabu bezüglich der monetären und fiskalischen Unabhängigkeit zu brechen.
Die institutionelle Struktur der Eurozone wurde ursprünglich aufgrund der Lehren aus der deutschen Hyperinflation in den 1920er Jahren erstellt. Die Geldpolitik sollte so verlässlich wie möglich von der Steuerpolitik isoliert werden, falls die Finanzpolitik außer Kontrolle geriete und die monetäre Staatsfinanzierung verlockend erscheint.
Ferner stellte man sicher, dass die Fiskalpolitik ohnehin auf die konservativen Ansichten ausgerichtet wird, um sich genau davor zu schützen. Was Deutschland – oder die alliierten Mächte, die die Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg erließen – aus dieser Episode glaubet gelernt zu haben, wurde als Bedingung für die Gründung der Eurozone erzwungen.
Diese Institutionen waren eng verzahnt mit dieser Lektion, aus der man durchaus auch einiges gelernt hatte. Wir sind weiter entfernt denn je von der stark verminderten Möglichkeit von Hyperinflationen. Doch das Problem ist, dass wir in den letzten 10 Jahren noch eine andere Lektion gelernt haben, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, die Nullzinsgrenze zu erreichen, höher ist als wir annahmen. Dies bedeutet aber, dass das von den alten Institutionen implizierte Delegierungs- und Zuordnungsschema dafür mangelhaft ist.
Die Politiker aus dem nördlichen Kern der Eurozone verhalten sich so, als seien die der EZB übertragenen geldpolitischen Ziele nur das Problem der EZB, d.h. Ziele also, die nur mit geldpolitischen Instrumenten verfolgt werden.
Dies ist jedoch nicht angemessen, wenn die konventionelle Politik an der effektiven unteren Zinsgrenze gefangen ist und Hilfe benötigt wird. In Anbetracht dessen, was wir heute wissen, ist die uneingeschränkte Übertragung der makroökonomischen Stabilisierung auf die Zentralbank und die bedingungslose Erzwingung von Haushaltsüberschüssen aber fehlgeleitet.
Die Finanzkrise hat ein erhebliches Defizit im Modell der Währungsunion aufgedeckt, welches wir zuvor nicht als wichtig erachteten.
In einem Land mit einer Regierung, die letztlich für ihre eigene Geld- und Fiskalpolitik verantwortlich zeichnet, ist es für diese Regierung im Prinzip einfach, sich so zu organisieren, dass die Finanzpolitik eingreift, wenn die Geldpolitik keinen Spielraum mehr hat.
Wenn es allerdings viele einzelne Fiskalagenten gibt, existiert kein übergeordneter Mechanismus, um eine neue Finanzpolitik zu koordinieren, insbesondere um die einzelnen Länder zu ermutigen, sich zudem noch um das Unterschreiten der Geldpolitik und der Verfehlung des Inflationsziels der Eurozone insgesamt zu kümmern.
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt war ein durchlässiger (d.h. nie wirklich perfekt durchgesetzter) Versuch, sich gegen eine allzu lockere Politik abzustimmen; die Sorge war, dass sich die Regierungen, die diese Regeln brachen zu sehr verschulden würden, indem sie auf die gemeinsame Zentralbank und andere implizite Aspekte der Union zählten, um sich selbst nötigenfalls zu retten.
Doch es gibt dagegen keinen Versuch Maßnahmen für das umgekehrte Problem zu koordinieren, nämlich eine übermäßig straffe Politik. Das ist nicht überraschend, denn angesichts der Geschichte der makroökonomischen Politik der meisten Länder der Eurozone wurde eine Unterauslastung der Kapazitäten vor der Krise nicht als sehr wahrscheinlich angesehen.
Das Problem verschärft sich in der Eurozone, da das geldpolitische Mandat vertraglich [in Artikel 127 des Lissabonner Abkommens] fixiert wurde. Die EZB verfolgt somit das Ziel der „Preisstabilität“ [in Übereinstimmung mit dem deutschen Grundgesetz] und interpretiert dabei selbst, was das bedeuten soll. Sie wählte dazu den Leitsatz „nahe bei, aber unter 2 Prozent“.
Eine Reaktion auf die Lehren aus der Finanzkrise könnte bestehen aus 1.) einer aggressiven und institutionell abgesicherten antizyklischen Fiskalpolitik an der effektiven unteren Zinsgrenze oder 2.) einem höheren Inflationsziel, im Idealfall auch aus einer Kombination beider Maßnahmen.
In Großbritannien bewahrte sich die Regierung das Recht, das Ziel für die Zentralbank festzulegen und eventuell neu zu definieren. In der Eurozone liegt dieses Recht bei der EZB, und das Mandat der EZB verbietet effektiv ein höheres Inflationsziel.
Diese Eigenschaft der Eurozone war einmal ein besonderes Kennzeichen der Union, kein Bug; doch jetzt ist es beides geworden.
Die Währungsunion wäre nicht möglich gewesen, wenn die deutschen Behörden es für wahrscheinlich gehalten hätten, dass die anderen Regierungen sich zusammenschließen und das Inflationsziel erhöhen könnten. Das Ziel in den Verträgen der Eurozone zu kodifizieren, was gleichzeitig viele andere Vorteile mit sich brachte und daher viel weniger als Ganzes hätte zerrissen werden können, galt als eine Garantie dafür.
In der alten Welt, als die effektive Zinsuntergrenze wie eine seltene Kuriosität erschien (auch wenn Japan zu der Zeit, als die EWU in Bewegung kam, darunter leiden musste), gab es offensichtlich keine größeren Probleme, die eine Veränderung des Inflationsziels so schwer gemacht hätten. Jetzt wissen wir, dass sie doch existieren.
Bemerkenswert, dass inzwischen selbst als eher konservativ geltende Ökonomen wie der ehemalige britische Zentralbanker Tony Yates angesichts der Eurokrise vorsichtig von den lange als unantastbar geltenden Vereinbarungen des Lissabonner Vertrages abrücken.