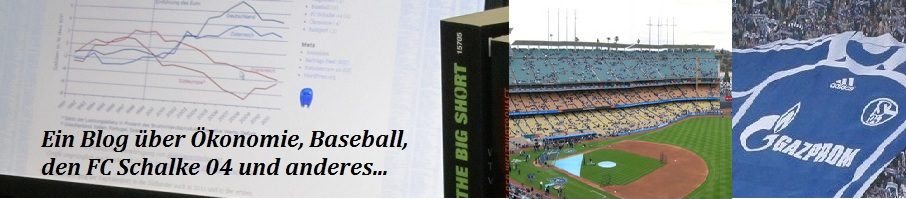Die von Eurostat am 20.10.2016 veröffentlichten Daten (EU28 Leistungsbilanzüberschuss von 13,5 Mrd. €) zeigen eindeutig, dass die EU28 auch im August 2016 einen erheblichen Leistungsbilanzüberschuss verzeichneten, nach einem Überschuss von 11,3 Mrd. Euro im Juli.

Leistungsbilanzsalden in Prozent des BIP der 19 Mitgliedstaaten der Eurozone für 2007 und 2015, aufsteigend sortiert nach den Daten von 2015
Das August-Resultat belief sich auf einen Zuwachs von 5,3 Mrd € im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Netto-Waren- und Dienstleistungshandel blieb dabei mehr oder weniger ausgeglichen.
Das atemberaubendste Ergebnis stellte allerdings der Sachverhalt dar, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss im August 2016 im Vergleich zum Vorjahr von 14,43 Milliarden Euro auf 17,87 Milliarden Euro anstieg. Den zweitgrößten Überschuss in der Eurozone erzielte Italien mit 3,37 Milliarden Euro.
Deutschland verfügt derzeit zusätzlich auch noch über einen Haushaltsüberschuss von rund 1,2 Prozent des BIP. Dies bedeutet, dass der private Inlandssektor massiv Mittel einspart, was nicht nur zu einer gedämpften Nachfrage innerhalb Deutschlands (und niedrigem Wachstum) führt, sondern auch die Ausgaben für den Import reduziert. Dies wiederum vermindert das Wachstum in anderen Nationen.
Die unglaublichste Tatsache ist aber die, dass die Europäische Kommission nichts gegen dieses massive Ungleichgewicht unternimmt, obwohl Deutschland wiederholt in Serie die Regeln gegen makroökonomische Ungleichgewichte gebrochen hat. Der Brüsseler Stiefel ist schnell dabei, Griechenland zu trietzen, bleibt aber sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Deutschland zu sanktionieren, obwohl das deutsche Verhalten für die Tragfähigkeit der gemeinsamen Währung wesentlich schädlicher ist.
Die obige Grafik zeigt die Leistungsbilanzsalden in Prozent des BIP für die 19 Mitgliedsländer der Eurozone ab 2007 und 2015. Sie sind aufsteigend sortiert auf der Grundlage der Daten von 2015.
In den frühen Tagen der Eurozone gab es dramatische Verschiebungen der Leistungsbilanzsalden (die die Handels- und Einkommensströme zwischen den Nationen widerspiegeln). Deutschlands „merkantilistische“ Strategie beherrschte diese ersten Jahre und sorgte für sehr große externe Überschüsse, die sich in der Ausweitung der externen Defizite in den peripheren Volkswirtschaften (PIIGS) widerspiegelten.
Was aber passiert, wenn eine Nation mehr exportiert als sie importiert (wir ignorieren der Einfachheit halber die Einkommensseite der Leistungsbilanz)? Der Nettoabfluss der realen Waren und Dienstleistungen würde schlicht von der Ansammlung von finanziellen Forderungen gegen den Rest der Welt begleitet.
Denn die Nachfrage nach der Währung dieser Nation zur Erfüllung der für die Exporte notwendigen Zahlungen würde das Angebot an den Devisenmärkten zum Ausgleich der Einfuhrausgaben überschreiten.
Wie könnte dieses Ungleichgewicht gelöst werden? Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Die offensichtlichste Lösung wäre die, in der sich Ausländer Geld von den inländischen Bewohnern leihen. Dies würde zu einer Nettokumulierung von Auslandsforderungen (Aktiva) führen, die von Gebietsansässigen in der Überschussnation gehalten würden. Eine weitere Lösung wäre, dass Nicht-Residenten ihre lokalen Bankguthaben abziehen, was bedeuten würde, dass die Nettoverbindlichkeiten gegenüber Nichtansässigen sinken würden.
Derzeit muss eine Nation mit einem andauernden Leistungsbilanzüberschuss Netto-Eigenkapitalabflüsse hinnehmen und/oder über die Zentralbank internationale Reserven (Fremdwährungsbestände) akkumulieren, wenn sie die Währung der Nation verkauft, um ihren Wechselkurs angesichts des Überschusses zu stabilisieren.
Bei den Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten laufen dagegen ausländische Kapitalzuflüsse (z. B. Kredite aus überschüssigen Nationen) auf und/oder ihre Zentralbanken verlieren Währungsreserven.
In den 80er-Jahren traten große Unterschiede in den Leistungsbilanzen zwischen den Staaten auf, da die Kapitalströme dereguliert wurden und viele Währungen nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems sehr stark schwankten.
Europäische Nationen wie Deutschland, die Niederlande und die Schweiz verzeichneten in der Regel große und anhaltende Leistungsbilanzüberschüsse, und mit einem erheblichen Anteil ihres Handels mit anderen europäischen Nationen wuchsen diese Ungleichgewichte sowohl innerhalb Europas als auch im Handel zwischen Europa und anderen Staaten.
Die deutsche Regierungspolitik (Hartz-Reformen – siehe unten) hat bewusst die Erweiterung der Ungleichgewichte in Europa bewirkt, indem die Konkurrenzfähigkeit der anderen Nationen durch diesen harschen Angriff auf ihre eigenen Arbeiter untergraben wurde.
Die nächste Grafik zeigt die Entwicklung der deutschen Leistungsbilanz (in % des BIP) von 1995 bis 2015. Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss von 8,6 Prozent im Jahr 2015 stellt ein Rekordergebnis für diese Nation dar.
Wie wir sehen, verzeichnete Deutschland als es in die Eurozone eintrat eher geringe externe Defizite, doch während des gesamten Beginns der gemeinsamen Währung verlagerte es deutlich den Fokus und fing an, nun ständig steigende Leistungsbilanzüberschüsse zu verzeichnen.
Über alle Sektoren betrachtet bedeutet ein Außenbeitrag von 8,4 Prozent des BIP und ein Haushaltsbilanzüberschuss von derzeit rund 1,2 Prozent des BIP einen Überschuss des privaten inländischen Sektors von rund 7,2 Prozent des BIP – eine gewaltige inländische Einsparung.
Die Bundesregierung hätte damit einen massiven Spielraum, ihre Nettoausgaben zu erweitern (und damit ihren Überschuss zu reduzieren), um die Inlandsausgaben und Importausgaben zu stimulieren, wodurch der massive und nicht nachhaltige Außenbeitrag reduziert würde.

Deutschlands Leistungsbilanz (in % des BIP) von 1995 bis 2015
Der deutsche Turnaround in dieser Entwicklung erfolgte 2001, als das Exportwachstum 6,83 Prozent betrug und die Importe dagegen nur um 1,9 Prozent zulegten.
Im Jahr 2003 enthüllte Bundeskanzler Schröder die „Agenda 2010“ seiner Regierung, die in Konzept, Gestaltung und Zeitrahmen mit der EU-Lissabon-Strategie in Einklang stand und bedeutete, dass seine Koalitionsregierung nun eindeutig eine neoliberale Agenda verfolgte.
Die Agenda 2010 zielt darauf ab, Einkommen-unterstützende Systeme anzugreifen. Sie wurde in der Sprache der Flexibilität und des Anreizes gekleidet, beruhte jedoch auf der Auffassung, dass die Massenarbeitslosigkeit das Ergebnis einer durch das Wohlfahrtssystem träge gewordenen Arbeitnehmerschaft sei und nicht der offensichtlicheren Alternative, dass sie auf Grund eines Mangels an Arbeitsplätzen entstanden wäre.
Die so genannte Hartz-Reform war ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie und entstand aus einer Untersuchungskommission 2002, die von Peter Hartz, einem führenden Volkswagen-Vorstand, geleitet und nach ihm benannt wurde.
Hartz selbst wurde damals von den neoliberalen Jubeltrupps dafür gelobt und gefeiert, musste aber 2007 eine Gefängnisstrafe wegen Korruption absitzen und fiel dadurch in Ungnade.
Das Ziel der „Reformen“ aber war klar: die Arbeitslosenunterstützung musste gekürzt und Arbeitsschutzmaßnahmen reduziert werden. Die Empfehlungen wurden vollständig von der Schröder-Regierung übernommen und ab Januar 2003 in vier Tranchen als Hartz I bis IV eingeführt.
Die Veränderungen, die mit Hartz I bis Hartz III einhergingen, fanden in den Jahren 2003 und 2004 statt, während Hartz IV im Januar 2005 begonnen hatte. Die Veränderungen gingen weit über die bestehende Arbeitsmarktpolitik hinaus, die eigentlich seit mehreren Jahrzehnten stabil gewesen war. Die Veränderungen stimmten mit denen überein, die in anderen Industriestaaten verfolgt wurden, und zwar nach der in der OECD-Jobstudie 1994 beschriebenen Agenda.
Die so genannte Angebotsseite konzentrierte sich darauf, dass eine kontinuierliche Einkommensstützung von einer Reihe von zunehmend belastenden Aktivitätstests und Ausbildungsprogrammen abhängig gemacht werden sollte.
Zudem gaben die Regierungen ihre Verantwortung auf, die Arbeitslosigkeit mit der ordnungsgemäß gezielten Schaffung von Arbeitsplätzen zu senken. Öffentliche Arbeitsagenturen wurden privatisiert, was eine neue Privatwirtschafts-„Industrie“ hervorbrachte, nämlich die Verwaltung der Arbeitslosen!
Das Ergebnis dieser deutschen Arbeitsmarktrepression (siehe unten) war ein Beschäftigungswachstum, das sich auf die sogenannten Mini-Jobs konzentrierte, die prekäre Arbeitsplätze mit extrem niedrigen Löhnen darstellten und somit die Arbeitnehmer von den Vorteilen des nationalen Einkommenswachstums und der Chance auf entsprechend wachsende Rentenansprüche ausschloss. Das andere offensichtliche Resultat war die Unterdrückung des realen Lohnwachstums und dadurch die fortlaufende Stagnation der inländischen Nachfrage.
Die Sparpolitik von Schröder zwang die deutsche Arbeitnehmerschaft zu einer harten Inlandseinschränkung, wodurch Deutschland nur noch durch die Ausweitung der Exportüberschüsse wachsen konnte, mit dem Resultat eines weiteren Ausbaus der Exporte und der Unterdrückung der Importausgaben.
Die großen Exportüberschüsse sorgten auch dafür, dass die inländisch gesparten Gelder an andere Länder ausgeliehen wurden. Deutschland erlebte nicht dieselbe Kreditexplosion wie andere Nationen, aber deutsche Banken waren beim Schuldenaufbau an anderer Stelle in Europa führend.
Die Unterdrückung des Konsums in Deutschland und die Abhängigkeit von Exporten zur Aufrechterhaltung des Wachstums waren für die europäischen Peripheriestaaten ausgesprochen schädlich.
Das Wachstum der Beschäftigung in Deutschland vor der Krise war nicht auf eine gut funktionierende Währungsunion zurückzuführen. Vielmehr spiegelte es ihre Fehlfunktionen wider, da es auf eine Ausweitung der Handelsungleichgewichte, riesige Überschüsse in Deutschland und einigen seiner Nachbarn sowie auf die Ausweitung der Defizite in der Peripherie, die von nicht nachhaltigen Kapitalströmen aus den ersteren zu letztgenannten abhing, ausgerichtet war.
Diese Art von Unilateralismus ist nicht sinnvoll in einer Währungsunion, vor allem in einer, die bewusst auf ein föderales Finanztransfer-System verzichtet. Sie hat nicht nur das Wohlergehen der deutschen EWWU-Partner untergraben, sondern auch den Lebensstandard der deutschen Arbeitnehmer reduziert.
Und wie die jüngsten Daten bestätigen, spielt Deutschland immer noch mit seinen Partnern in der Währungsunion, doch diesmal war es selbst aktiv, um den Wohlstand im Rest der Eurozone zu reduzieren.
Der gescheiterte makroökonomische Ungleichgewichtsprozess
Im März 2010 antwortete der Europäische Rat in Brüssel auf die anhaltende Krise. Die Führungsspitze gab immerhin zu, dass die Situation düster aussehe, wählte aber genau den falschen Anpassungspfad. Denn anstatt die lächerlichen Fiskalregeln zu reduzieren, verschärften sie sie noch.
Aus der Erklärung der Staats- und Regierungschefs des Euro-Raums vom 25. März 2010:
Die derzeitige Lage zeigt, dass es notwendig ist, die bestehende Struktur zu stärken und zu ergänzen, um die finanzielle Nachhaltigkeit in der Eurozone zu gewährleisten und ihre Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten zu verbessern.
Für die Zukunft müssen die Überwachung der Wirtschafts- und Haushaltsrisiken und die Instrumente zur Prävention, einschließlich des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, gestärkt werden. Darüber hinaus benötigen wir ein robustes System für die Krisenbewältigung unter Beachtung des Prinzips der eigenen Haushaltsverantwortung der Mitgliedstaaten.
Die deutsche Agenda war eindeutig, mit der die Bedingungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (SGP) noch belastender gemacht werden sollten und die noch verfügbare Fiskalpolitik weiter zu beschränken und damit dafür zu sorgen, dass nur noch Nationen mit starken Exportpositionen eine Chance auf nachhaltiges Wachstum haben würden.
Bald nach der Tagung des Europäischen Rates im März 2010 nutzte der konservative deutsche Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn seinen „Wall Street Journal“-Leitartikel (19. April 2010) – Wie man den Euro rettet dazu, Nationen wie „Griechenland, Italien, Spanien und Portugal“ zu predigen, „ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion nicht mehr als das Recht einzusetzen, ihre Einfuhren mit Anleihen und nicht mit echten Ressourcen zu bezahlen“.
Er forderte einen neuen Stabilitäts- und Wachstumspakt (SGP):
… einer, der so formuliert werden müsste, um eine eiserne Verschuldungsdisziplin aufzuerlegen. Was erforderlich ist, sind modifizierte Schuldenregelungen, kräftige Sanktionen und vor allem ein System von Regeln, die die Erhebung von Strafen automatisieren und keinen Platz für politische Einmischung lassen.
Was daraufhin folgte, ist bekannt. Die Europäische Union führte drei neue „Governance“-Maßnahmen ein – das Six-Pack, das Two-Pack und den Fiskalpakt. Alle drei Initiativen zielten darauf ab, die fiskalpolitische Flexibilität der nationalen Regierungen weiter zu beschränken. Alle drei führten die Währungsunion weiter in den Sumpf und weiter weg von einem wirkungsvollen Ausweg aus ihrer Krise.
Die Annahme war aber, dass, wenn nur die Finanzvorschriften strenger und das Verhalten stärker überwacht und kontrolliert werden würden, der SGP durchgesetzt und die so genannte Finanzkrise zerstreut werden könnte. Dies signalisierte die Bereitschaft der europäischen Führung, höhere Arbeitslosigkeit und Armut und nicht einen Anstieg der Staatsausgaben zum hauptsächlichen Anpassungsmechanismus zu machen.
Der so genannte „verstärkte Stabilitäts- und Wachstumspakt“ (SGP) wurde am 13. Dezember 2011 offiziell verabschiedet. Das offizielle Memorandum der Europäischen Kommission dazu (12. Dezember 2011) – „Six-Pack“ der EU-Wirtschaftsregierung tritt in Kraft – sagte aus, das so genannte „Six-Pack“ umfasse „fünf Vorschriften und eine Richtlinie“.
Die Innovation war die Schaffung eines neuen „makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens“, das als „neuer Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismus“ bezeichnet wurde. Grundsätzlich würden Nationen schneller in das „Excess Deficit Procedure“ (EDP) übergehen und es würde dann auch härtere Sanktionen für die Nichteinhaltung geben.
Das Six-Pack spezifizierte eine strengere Auferlegung von finanziellen Sanktionen wenn eine Nation den „spezifischen Empfehlungen“ nicht folgen könne, um ihr Defizit unter 3 Prozent des BIP zu bekommen. Wenn die „60%-Referenz für die Staatsschuldenquote nicht eingehalten wird“, dann würden die Beschränkungen des EDP einsetzen, „auch wenn das Defizit noch unter 3% liegt und die Nation muss dann die Lücke zwischen ihrem Schuldenstand und der 60%-Referenz … mit einem zwanzigstel jährlich (durchschnittlich über 3 Jahre) schließen“.
Es gab andere hochfliegende Aussagen über Schock und Ehrfurcht, wenn eine Regierung es wagte, ihre fiskalischen Kapazitäten zur Senkung der Massenarbeitslosigkeit zu nutzen.
Wie es in der jüngsten spanischen Farce zu sehen war, musste man diese harten Worte und neuen Regeln nicht wörtlich verstehen. Um die Konservativen der PP in Spanien zu stützen, drückte die Europäische Kommission 2015 bei der finanzpolitischen Bilanz der spanischen Regierung alle Augen zu, und überraschenderweise stieg das Defizit auf 5,2 Prozent des BIP und das reale BIP-Wachstum wandelte sich aus dem negativen Zahlen ins Positive. Ebenso begann die Arbeitslosigkeit dann zu sinken (siehe auch -> Das verfügbare Haushaltsdefizit der spanischen Regierung steigt und damit auch das reale BIP-Wachstum – für mehr Diskussion zu diesem Punkt).
Interessant für diesen Beitrag ist jedoch die Reihe von Interventionen, die die Europäische Kommission im Rahmen der so genannten Excessive Imbalances Procedure (EIP) erarbeitet hatte, mit der die makroökonomischen Ungleichgewichte (insbesondere die Stückkosten usw.) gesenkt werden sollten. Die Europäische Kommission nahm für sich das Recht in Anspruch, ganze Nationen dazu zwingen zu wollen, „einen klaren Fahrplan und Fristen für die Durchführung von Korrekturmaßnahmen“ vorzulegen.
Das gesamte System sollte mit einer rigorosen Durchsetzung (Geldbußen von 0,1% des BIP) und einer zentralen Intervention im Haushaltsprozess einer Nation einer umfassenden Überwachung unterzogen werden (EU-Überwachung).
Die Führer der Eurozone waren auch mit diesen neuen Beschränkungen noch nicht zufrieden. Sie beschlossen, unter dem Deckmantel des 2012 geschlossenen Vertrages über Stabilität, Koordinierung und Regierungsführung in der Wirtschafts- und Währungsunion (TSCG) – auch „Fiskalpakt“ genannt – eine noch aufwendigere Fiskalregelung einzuführen. Diese Veränderungen wurden vor allem von den Deutschen vorangetrieben, die im Jahre 2009 eine „Regel für einen ausgeglichenen Haushalt“ oder „Schuldenbremse“ in ihrem Grundgesetz verankert hatten(Verfassung).
Ab 2016 wird es für die Bundesregierung illegal sein, ein strukturelles Defizit von mehr als 0,35 Prozent des BIP auszuweisen, während es den Bundesländern ab 2020 verboten sein wird, überhaupt Defizite zu machen. Dies bedeutet effektiv, dass einmal in Betrieb, die laufenden Staatsschulden schließlich nach und nach verschwinden werden. Bisher gab es Schuldengrenzen für die deutsche Wirtschaftspolitik, aber nach 2016 soll die Obergrenze nicht mehr verletzt werden können.
Nur in außergewöhnlichen und seltenen Situationen, die außerhalb der Kontrolle der Regierung liegen würden, können die Regeln vorübergehend verletzt werden, aber etwaige Defizite müssten bald durch Überschüsse ausgeglichen werden.
Vorhersehbar erschien dazu im Monatsbericht Oktober 2011 der Deutschen Bundesbank ein geradezu lyrischer Artikel – Die Schuldenbremse in Deutschland – Schlüsselaspekte und Umsetzung – über den neuen, härteren Ansatz in Deutschland. Die Bundesbank sah den Wandel als „eine sehr willkommene Entwicklung und eine deutliche Verbesserung“ an.
Im Einklang mit ihrer deflationären Ausrichtung empfahl sie, dass alle Ebenen der Regierung:
… eine Sicherheitsmarge unter die verfassungsrechtliche Obergrenze einzurichten… um die Notwendigkeit kurzfristiger Anpassungen, die prozyklische Auswirkungen haben könnten, insbesondere bei unerwarteten negativen Entwicklungen [zu vermeiden].
Mit anderen Worten, sie wollten, dass die Regierung die ständigen haushaltspolitischen Überschüsse als eine Selbstverständlichkeit ansieht, mit denen das Wirtschaftswachstum unabhängig von der Wirtschaftslage fiskalisch konstant gesteuert werden kann. Im Kontext der deutschen Innenpolitik hieße dies, dass die einzige Quelle des Wachstums Nettoexporte wären.
Eine Schuldenbremse bedeutet, dass alle Investitionen in die öffentliche Infrastruktur aus den laufenden Umsätzen kommen müssen, was gegen das grundlegende ökonomische Prinzip verstößt, dass die Kosten und der Nutzen einer solchen Regelung im Laufe der Zeit verteilt werden sollten, so dass nicht die jetzige Generation die Kosten trägt und die zukünftigen Generationen nur die Vorteile genießen.
Ferner geht es um die Annahme symmetrischer Konjunkturzyklen, so dass etwaige Defizite, die in einem Abschwung auftreten, durch Überschüsse in Perioden stärkerem Wachstum mehr als kompensiert werden können. Aber Zyklen sind in der Regel asymmetrisch und tiefe Rezessionen können erweiterte Haushaltsdefizite verlangen, um die Erholung aufrecht zu erhalten.
Der entscheidende Punkt ist der, dass die Bundesbank nicht die deutsche Mitgliedschaft in der Eurozone berücksichtigte oder die Massenarbeitslosigkeit erwähnt hatte, die diese Nation als Folge des Mangels an Ausgaben in der gesamten Währungsunion umringten, und stattdessen schrieb:
Nicht zuletzt angesichts der Bedeutung der deutschen Schuldenbremse als Benchmark innerhalb des Euro-Währungsgebiets ist es entscheidend, dass sie kräftig und in einer Weise umgesetzt wird, die ihrer Absicht entspricht.
Der von der Europäischen Union verabschiedete Fiskalpakt verkörperte leider einen Großteil des deutschen Ansatzes, einschließlich der Präferenz, dass der „ausgeglichene Haushalt“ bindend und in permanente Verfassungsbestimmungen eingebettet ist.
Die so genannten „unabhängigen“ Überwachungs- und Überwachungsgremien würden Regelverstöße schnell an den Gerichtshof der Europäischen Union verweisen, dem nach Artikel 8 des Vertrages neue Kapazitäten gewährt wurden, um seinen Anteil an der Durchsetzung der Austerität leisten zu können.
Aber zurück zu dem im Six-Pack eingebetteten „Makroökonomischen Ungleichgewichtsprozess“, der die inhärenten, antipolitischen Vorurteile aufdeckt, die die europäische Politik dominieren.
Das erklärte Ziel des MIP-Überwachungsmechanismus wurde in einem zu diesen Anlass veröffentlichten Papier vom Februar 2012 Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances beschrieben.
Wir lesen, dass er entworfen wurde, um:
… frühzeitig potenzielle Risiken zu identifizieren, das Entstehen schädlicher makroökonomischer Ungleichgewichte zu verhindern und die bestehenden Ungleichgewichte zu korrigieren.
Das so genannte MIP Scoreboard verwendet zehn „Frühwarnindikatoren“, die Informationen über „makroökonomische Ungleichgewichte und Wettbewerbsverluste“ liefern, die leicht zu berechnen und zu kommunizieren sind. Man beachte dabei den Schwerpunkt auf früh!
Schwellenwerte (positiv und negativ) werden bereitgestellt, um zu beurteilen, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Die Prioritäten waren klar. Eine Nation, die in den letzten drei Jahren eine Arbeitslosenquote von 9,9 Prozent erlitten hatte, gilt angesichts der Warnschwelle von 10 Prozent nicht als unausgewogen.
Die Kommission wählte diese sehr hohe Schwelle aufgrund einer „Fokussierung auf die Anpassung der Arbeitsmärkte und nicht auf konjunkturelle Schwankungen“.
Was das bedeutet? Dass sie das Problem der Arbeitslosigkeit nicht in Bezug auf die durch mangelhafte Ausgaben verursachten unzureichenden Arbeitsplätze setzten, sondern die so genannten „strukturellen“ Fragen als einzig relevante Politik ansahen. Damit wiederum konzentrierten sie ihre Aufmerksamkeit auf „Markt-Hindernisse“, das übliche neoliberale Angebotsseiten-Vorurteil, welches bereits gescheitert war, als es in den frühen 1990er Jahren der dominierende Ansatz wurde.
In dem jährlichen „Alert-Mechansim-Report“ der Kommission, der auf einer Überprüfung des MIP-Anzeigers beruht, ist jeder Hinweis auf die Arbeitslosigkeit gewöhnlich von einigen Schlussfolgerungen begleitet, dass die Löhne zu hoch seien und entsprechend dem Produktivitätswachstum verringert werden müssten.
Es gibt aber keinerlei Erkenntnis dafür, dass die anhaltende Rezession zu einem Rückgang des Produktivitätswachstums und der Arbeitsplätze aufgrund fehlender Ausgaben geführt hätte.
Die europäischen Entscheidungsträger sind demnach also mit sehr hoher Arbeitslosigkeit zufrieden und verbergen ihre eigentlichen Absicht mit einer Sprache der Täuschung und Verschleierung. Ein weiterer Trugschluss zeigt sich in der Art und Weise, wie sie mit Leistungsbilanzdefiziten und -überschüssen umgehen, die im Mittelpunkt dieses Beitrages stehen.
Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass im Gegensatz zu den Leistungsbilanzdefiziten:
… anhaltende Leistungsbilanzüberschüsse nicht die gleichen Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Auslandsverschuldung und der Finanzierungskapazitäten aufwerfen, die das reibungslose Funktionieren des Euro-Währungsgebiets beeinträchtigen könnten.
Als Ergebnis dieses Werturteils erkannte das MIP folglich:
… ein höheres Maß an Dringlichkeit … [bei] … Ländern mit großen Leistungsbilanzdefiziten und Wettbewerbsverlusten.
Die obere Warnschwelle (für einen Überschuss) beträgt 6% des BIP. Aufgrund der Logik ausgeglichener Sektoren muss der private Sektor einer Nation mit einer entsprechend ausgeschöpften Leistungsbilanzüberschreitung demnach insgesamt 6 Prozent des BIP einsparen. Wo aber werden diese Einsparungen stattfinden?
Zur externen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der Manipulierung des Wechselkurses siehe die Beiträge Deutschland ist kein Modell für Europa – es scheitert im Ausland und zu Hause und Deutschland sollte sich selbst im Spiegel betrachten. Die Hartz-Reformen reduzierten die Fähigkeit der Arbeitnehmer, sich am Produktivitätswachstum der Wirtschaft zu beteiligen und unterdrückten so die Binnennachfrage.
Profitable Anlagechancen waren in der deutschen Wirtschaft dadurch begrenzt und das Kapital suchte daher Gewinne an anderer Stelle im Ausland. Die anhaltend großen externen Überschüsse (und 6 Prozent sind groß) waren der Grund, dass so viel Schulden in Spanien und anderswo entstanden.
Kurz nach der Einführung der neuen Verfahren veröffentlichte die Europäische Kommission am 3. März 2014 den Alert Mechanism Report 2014.Dieser kam zu dem Ergebnis, dass Deutschland ein makroökonomisches Ungleichgewicht aufwies, da sein Leistungsbilanzüberschuss über der Schwelle von 6 Prozent lag. Die Kommission räumte ein, dass die großen Überschüsse zum Teil auf die Unterdrückung der Inlandsausgaben und damit auch der Einfuhren zurückzuführen seien.
Aber es lobte die Überschüsse, weil sie „Einsparungen zur Verfügung stellten, die dann im Ausland investiert werden“. Der Punkt ist aber der, dass bei einem Leistungsbilanzüberschuss von 6 Prozent Deutschland zwangsläufig große Kapitalströme für den Rest der Welt generiert. Solche Überschüsse beruhen nämlich auf der Kompensierung externer Defizite an anderer Stelle.
Die Europäische Kommission kam zu dem Schluss, dass Deutschland Wege finden müsse, die Binnennachfrage und das Wachstumspotential der Wirtschaft zu stärken. Die höhere Binnennachfrage in Deutschland erfordere dann aber ein schnelleres Lohnwachstum, sowohl um den sehr bescheidenen Inlandskonsum zu steigern als auch um Investitionen für den heimischen Markt anzuziehen.
Aber eine solche Veränderung wäre im Widerspruch zu der kaufmännischen Denkweise, die die Nation dominiert, weil sie den Wettbewerbsvorteil verringern würde, den Deutschland über andere Nationen genießt, die ihre Arbeiter gerechter behandelt haben. Und natürlich hat die Europäische Kommission nichts getan, um Deutschland daran zu hindern, dieses System noch weiter zu spielen.
Im jüngsten Alert Mechanism Report 2016 (veröffentlicht am 26. November 2015) konstantierte die Kommission:
Länder wie Deutschland, die Niederlande … verzeichnen weiterhin sehr hohe Überschüsse. Diese großen und anhaltenden Überschüsse zeigen keine Korrekturneigung. Während in Ländern mit einer alternden Bevölkerung wie Deutschland Leistungsbilanzüberschüsse zu erwarten sind und die jüngsten Ölpreis- und Wechselkursentwicklungen die Handelsbilanz positiv beeinflussten, scheint der aktuelle Wert des Überschusses deutlich über den wirtschaftlichen Fundamentaldaten zu liegen.
Der Versuch zu behaupten, dass die unterdrückte Einfuhrsituation in Deutschland und die massive Sparquote auf eine alternde Bevölkerung zurückzuführen sind, ist eine typische Verschleierung durch die Europäische Kommission.
Am 26. Februar 2016 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren Länderbericht Deutschland 2016, eine der neuen „eingehenden Überprüfungen“ im Rahmen des MIP.
Er stellte fest, dass
1. „die Erholung der privaten Investitionen uneinheitlich war und trotz der jüngsten Anstrengungen die öffentlichen Investitionen niedrig bleiben“.
2. „Schwache Investitionen zum hohen und anhaltenden Leistungsbilanzüberschuss beigetragen haben und Risiken für das zukünftige Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft darstellen“.
3. „Insgesamt hat Deutschland nur geringe Fortschritte bei der Bewältigung der länderspezifischen Empfehlungen von 2015 gemacht“ – mit anderen Worten, es hat genau den Regeln widersprochen, mit denen es andere Nationen wie Griechenland und Portugal dazu zwingt, die Bürger dieser Länder mit hohen Kosten zu belegen.
4. „Der anhaltend hohe Leistungsbilanzüberschuss hat sich im Jahr 2015 weiter ausgeweitet und wird voraussichtlich im Zeitraum 2016-2017 über 8% des BIP bleiben … der Überschuss und die Beharrlichkeit spiegeln eher die strukturellen Merkmale der Wirtschaft wider, einschließlich der starken Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung und der hohen Einnahmen aus Private Investitionen im Ausland. Aber es spiegelt auch gedämpfte Investitionen und ein hohes Maß an Ersparnissen wieder.“
5. „Es scheint mehr Raum für das Lohnwachstum zu geben, ohne die deutsche Konkurrenzfähigkeit zu gefährden“ – mit anderen Worten: Deutschland sollte aufhören, mit seinen Partnerländern zu spielen und es seinen eigenen Bürgern endlich erlauben, ein echtes Lohnwachstum zu genießen.
6. „Die öffentlichen Investitionen bleiben gedämpft … Damit bleibt eine erhebliche Investitionslücke bestehen. Die Gestaltung der fiskalischen Beziehungen des Bundes könnte zu einer anhaltenden (insbesondere kommunalen) Unterinvestition beigetragen haben. Darüber hinaus haben sich die öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildung und Forschung in den letzten Jahren nur geringfügig erhöht und dürften das nationale Ziel für 2015 nicht erreicht haben „- mit anderen Worten: Die deutsche Regierung untergräbt die Zukunft ihrer nächsten Generation gedankenlos, indem sie laufende Haushaltsüberschüsse bei gleichzeitiger Unterdrückung des wesentlichen Wachstums der öffentlichen Infrastruktur generiert.
Export-geleitete Wachstumsbesessenheit
Trotz der in ihrem jährlichen Handels- und Entwicklungsbericht 2010 umrissenen Warnungen der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) verfolgt die Europäische Kommission weiterhin einen exportorientierten Wachstumsansatz.
UNCTAD stellte eine nüchterne Bewertung der Dominanz der exportorientierten Wachstumsstrategien unter den politischen Entscheidungsträgern und multilateralen Organisationen wie dem IWF und der OECD fest.
Die UNCTAD vertrat die Auffassung, dass ein Vertrauen auf solche Strategien und die Verhängung steuerlicher Sparprogramme das Wachstum abschwächen und die Armut erhöhen würden.
Die UNCTAD kam zu dem Schluss, dass ein grundlegendes Umdenken erforderlich wäre, um die Politik zur Stimulierung der Binnennachfrage und der Schaffung von Arbeitsplätzen neu auszurichten.
Die UNCTAD war der Ansicht, dass eine Ausweitung der Fiskalpolitik in Europa unerlässlich sei, um eine längere Rezession und wirtschaftliche Stagnation zu vermeiden.
Die aktuelle Politik-Orthodoxie in der Eurozone befindet sich im Widerspruch zu dieser Empfehlung. Die europäischen Entscheidungsträger haben das Argument heraufbeschworen, dass, wenn die Staatsdefizite gesenkt und die so genannte „interne Abwertung“ verfolgt wird (dh. Kürzungen der Löhne, der Renten und anderer Produktionskosten), zwei Wachstumsquellen entstehen werden.
Zuerst wird es einen „ricardianischen“ privaten inländischen Ausgabenboom geben, wie zuvor beschrieben. Zweitens wird, auch wenn die Inlandsausgaben nicht zunehmen, der Prozess der Lohn- und Preisdeflation, der durch die „interne Abwertung“ hervorgerufen wird, die externe Wettbewerbsfähigkeit der Nation erhöhen und das Wachstum der Exporte fördern.
Die Evidenz deutet darauf hin, dass die interne Abwertung keine gute Grundlage für Wachstum darstellt. Erstens ist es eine Strategie des „Race to the Bottom“, mit der versucht wird, die Stückkosten durch Kürzungen der Löhne zu senken, welche allerdings die Inlandsausgaben untergraben.
Wenn dann auch noch die Moral der Arbeitskräfte infolge der Lohnkürzungen sinkt, erscheint es durchaus wahrscheinlich, dass die industrielle Sabotage und die Fehlzeiten steigen und die Arbeitsproduktivität ausgehöhlt wird. Darüber hinaus dürften die Gesamtinvestitionen des Unternehmens infolge der rückläufigen Ausgaben fallen, was ebenso auch das Produktivitätswachstum erodiert.
Es gibt also keine Garantie dafür, dass die Lohnstückkosten deutlich sinken werden. Stattdessen existieren robuste Forschungsergebnisse, die die Vorstellung unterstützen, dass durch die Zahlung hoher Löhne und die Gewährleistung einer sicheren Beschäftigung der Arbeitnehmer Unternehmen ein höheres Produktivitätswachstum erzielen können und die Nation ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert.
Die Eurostat-Daten zeigen, dass in den Jahren 2008 bis 2013 die Arbeitsproduktivität pro Arbeitsstunde in Deutschland um 1,8 Prozent gestiegen ist, in Griechenland aber um 8,5 Prozent und in Italien um 0,7 Prozent zurückging. So scheitert der interne Abwertungsansatz nicht nur daran, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sondern schließt auch einen geringeren Produktivitätspfad mit ein, der den Anstieg des realen Lebensstandards untergräbt.
Die massiven Kosten für die Nationen, die diesen Sparprogrammen in Form von Millionen verloren gegangener Arbeitsplätze und der sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit unterworfen sind, sind auf lange Sicht deutlich höher als alle möglichen Vorteile. Zweitens kann die Auferlegung der heimischen Austerität und die Abhängigkeit von Nettoexporten für das Wachstum nicht logischerweise für alle Nationen gleichzeitig funktionieren.
Verstärkt die interne Abwertung die externe Wettbewerbsfähigkeit?
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlicht monatliche „reale effektive Wechselkursindizes“ (REER), die als international anerkannte Maßstäbe für die externe internationale Wettbewerbsfähigkeit gelten, mit denen die nominalen Wechselkurse an andere Daten über die Inlandsinflation und die Produktionskosten angepasst werden. Wenn der reale effektive Wechselkurs für eine Nation steigt (sinkt), dann signalisiert er einen Verlust (Gewinn) ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Die nächste Grafik zeigt die Entwicklung der realen effektiven Wechselkurse seit Januar 1999 bis September 2016 für ausgewählte Länder der Eurozone und Island. Zwei Teilbeispiele werden dargestellt: von Januar 1999 bis Dezember 2007 und von Januar 2008 bis September 2016, die ungefähr mit der Periode des Wachstums und der Periode der Rezession und ihrer Folgen übereinstimmen.
Die Daten zeigen, dass nach der Einführung des Euro die internationale Wettbewerbsfähigkeit für alle gezeigten Länder abgenommen hat, außer für Frankreich und Deutschland. Weiterhin vermochte Deutschland relative Vorteile gegenüber allen andern zu erreichen.
Nach der Krise folgte als allgemeine Tendenz ein breites Absinken der effektiven Wechselkurse. Allerdings war der reale effektive Wechselkurs von Griechenland im September 2016 nur um 8,8 Prozent niedriger als im Januar 2008 als Reflexion des massiven erduldeten Sparprogramms. Zum Vergleich: Der reale effektive Wechselkurs für Deutschland ist seit Anfang 2008 um 10,6 Prozent gesunken.
Von diesen Euro-Ländern hat sich nur Irland seit Beginn der Krise gegenüber Deutschland verbessern können. Die anderen haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren, was darauf hindeutet, dass die massiven Schmerzen aus dem internen Abwertungsprozess (Massenarbeitslosigkeit, Lohnkürzungen usw.) nichts gebracht haben.

Reale Wechselkursschwankungen von Januar 1999 bis September 2016
für ausgewählte Euro-Länder und Island
Auffällig ist dagegen der Vergleich dieser festen Wechselkursnormen mit Island. Die grundlegenden Unterschiede zwischen den Euro-Staaten und Island sind dreifach: (a) Island gibt seine eigene Währung heraus, während die anderen Nationen eine Fremdwährung verwenden müssen; (b) Island hat einen variablen Wechselkurs; und (c) Island setzt seinen eigenen Zinssatz fest. Dies sind die Merkmale, mit denen sich souveräne von nicht souveränen Nationen in Bezug auf die im Gebrauch befindliche Währung unterscheiden.
Island hat in den letzten Jahren einen erheblichen Zuwachs an internationaler Wettbewerbsfähigkeit erlebt, mit weniger Austerität und weniger Härte gegenüber seinen Bürgern. Die Ergebnisse für Island sind noch konservativ ermittelt, trotzdem betrug ihr prozentualer Gewinn an Wettbewerbsfähigkeit seit ihrem maximalen Indexwert (November 2005) bis September 2016 17,8 Prozent, übertroffen nur noch von Irland (21 Prozent). Es gibt allerdings Anlass zu Misstrauen gegenüber den irischen Daten angesichts der neun Empfindlichkeiten, die in den letzten Quartalen in Bezug auf das Steuerrecht usw. enthüllt wurden.
Drittbester war Deutschland, es verbesserte sich um 14,3 Prozent von seinem Höchstwert im Januar 1999 bis zum September 2016. Mehr dazu in dem Beitrag Export-geführte Wachstumsstrategien werden scheitern.
Schlussfolgerung
Insgesamt behält Deutschland weiterhin seine zerstörerische Rolle in der Eurozone, indem es die Inlandsnachfrage unterdrückt, die Sparpolitik den Partnerländern aufzwingt und sich hinter dem gemeinsamen Wechselkurs versteckt. Wenn es keine gemeinsame Währung gäbe, wäre die Deutsche Mark erheblich aufgewertet worden und hätte den Handelsvorteil bis zu einer gewisse Marge untergraben.
Was wir sehen, ist eine Art Wiederholung des festen Wechselkurssystems unter Bretton Woods, angewandt auf die Eurozone. Die einzige Anpassung, die für Nationen mit externen Defiziten angesichts der von Deutschland geführten massiven Außenüberschüsse möglich ist, besteht in einer Unterdrückung der Inlandsnachfrage durch Lohnknechtschaft, Rentenkürzungen usw.
Es ist offensichtlich, dass diese Politik es den anderen Mitgliedstaaten nicht erlaubt, relativ wettbewerbsfähige Vorteile gegenüber Deutschland zu erzielen. Es ist stattdessen ein Race-to-the-bottom – in Richtung der Verarmung der europäischen Bürger.
Und natürlich ist dies ein großes Problem aufgrund der fiskalischen Bevormundung und Unterdrückung. Griechenland könnte seine Depression leicht selbst lösen, wenn es frei wäre, die Staatsausgaben auszudehnen. Die deutsche Verdrängung der Importe wäre dann nur noch ein Problem für seine eigenen Bürger, die in diesem Falle infolge der merkantilistischen Strategie wesentlich schlechter gestellt wären.
Deutschland sollte auch seine öffentlichen Nettoausgaben ausbauen, um eine gewisse Nachfrage in der gesamten Eurozone zu gewährleisten. Man kann zwar durchaus die Argumente der Bundesbank verstehen, dass aufgrund der niedrigen öffentlichen Einfuhren die direkten Auswirkungen auf die Exporte der übrigen Mitgliedstaaten der Eurozone ziemlich bescheiden wären.
Doch die Multiplikatoreffekte diese Anreizes würden die privaten Einkommen in Deutschland erheblich ankurbeln und das Importwachstum sehr viel stärker fördern – was eben Nationen wie Griechenland (durch den Tourismus usw.) zugute kommen würde.
(Eigene Übersetzung eines Blogbeitrages des australischen Ökonomen Bill Mitchell)