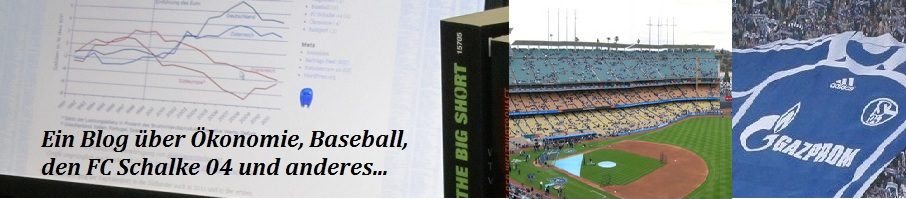Einer derjenigen Volkswirte, die sich vor allem auch mit den Auswirkungen von Wirtschaftskrisen beschäftigten, war der hierzulande nahezu unbekannte Josef Steindl.

Blick in die New Yorker Börse
Der Österreicher zählte zu den umtriebigsten Wissenschaftlern des sogenannten Postkeynesianismus, einer ökonomischen Schule, die sich vor allem mit der Weiterentwicklung der Ideen von John Maynard Keynes beschäftigte.
In seinen ersten Jahren am Institut für Konjunkturforschung, dem heutigen Öster-reichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) lernte Steindl ebenso wie viele andere die ökonomische Theorie unter dem Einfluss der Neoklassik sowie der sogenannten Österreichischen Schule.
Doch schon frühzeitig änderte sich seine Sicht der wirtschaftlichen Zusammenhänge, als er erstmals mit der damals neuen Strömung des Keynesianismus in Kontakt trat, maßgeblich aufgrund eines Seminars von Gerhard Tintner über die „Allgemeine Theorie“ von J. M. Keynes.
Angesichts der unzureichenden Erklärungsansätze der gängigen Lehren zur damals herrschenden Massenarbeitslosigkeit wandte sich Steindl endgültig von der Österreichischen Schule ab und wechselte 1937 mit der Publikation seines Artikels „Der Konjunkturzyklus von Harrod“ (Steindl, 1937), einer Rezension eines Buches von Roy Harrod, ins Lager der Anhänger der von Keynes inspirierten neuen Lehre.
1938 emigrierte Steindl nach dem „Anschluss Österreichs“ nach England und traf in Oxford u. a. Michaeł Kalecki, dessen ökonomische Thesen sein Denken von da an entscheidend prägten. Zusammen mit ihm durchbrach er die statische Enge der neoklassischen Synthese und ergänzte die klassische Ökonomie um dynamische Elemente. Unter dem Einfluss Kaleckis wurden vor allem die Marxschen Themen Monopol/Oligopol und Wirtschaftskrisen die zentralen Grundzüge seiner wirtschaftspolitischen Arbeiten.
So erklärte Steindl in seinem Buch „Maturity and Stagnation in American Capitalism“ (1952) die Stagnation der amerikanischen Wirtschaft zwischen den Weltkriegen mit Tendenzen zur Oligopolisierung. Bei Märkten mit nahezu vollständiger Konkurrenz (polypolistischer Wettbewerb) entwickeln sich die Gewinnspannen sehr flexibel, bei schwacher Nachfrage sinken die Preise und Überkapazitäten werden dadurch relativ schnell beseitigt.
Bei Industrien mit wenigen Anbietern dagegen sorgen deren größer werdender Anteil zu einer Verringerung der Kapazitätsauslastung und damit auch der Investitionen. Je stärker dieser Konzentrationsprozess sich entwickelt, umso länger dauert die Erholung einer solchen Wirtschaft nach einem Konjunkturabschwung.
Nur aufgrund einer Reihe von Faktoren, die Steindl gründlich eruierte, führten diese und ähnliche Oligopolisierungs- und Konzentrationstendenzen zwischen den fünfziger und siebziger Jahre nicht zu einer Stagnation der führenden Volkswirtschaften, sondern zum sogenannten „Goldenen Zeitalter des Kapitalismus“.
Steindl zufolge waren diese Faktoren:
1. ein wachsender öffentlicher Sektor, der mit antizyklischen Maßnahmen die Nachfrage auch in Zeiten konjunktureller Schwächen hochhielt,
2. die damalige internationale Zusammenarbeit der Wirtschaftspolitik, vor allem auf den Feldern der Konjunktur- und Währungspolitik (Stichwort Bretton Woods),
3. die Entwicklung technischer Innovationen und neuer Produkte, durch die besondere Investitionsanreize entstanden,
4. eine stabile Lohnquote durch die Zusammenarbeit von Unternehmern und Gewerkschaften.
Es gehört nicht viel Erkenntnis dazu, festzustellen, dass alle diese Faktoren in der heutigen ökono-mischen Politik bis vor kurzem so gut wie keine Rolle mehr gespielt haben. In Europa tun sie es auch heute noch nicht wirklich.
Damals dagegen stärkten die steigenden öffentlichen Ausgaben die effektive Nachfrage. Solange diese Ausgaben durch höhere Steuern auf Gewinne refinanziert werden, haben sie expansive Auswirkungen.
In den letzten Jahrzehnten aber sanken die Steuersätze mit Hinweis auf die internationale Konkurrenz und die öffentlichen Ausgaben wurden zunehmend aus der höheren Besteuerung der Lohn- und Gehaltseinkommen gedeckt, was im Zusammenhang mit steigenden Importquoten den Multiplikator öffentlicher Ausgaben erheblich verringerte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte man auch mit internationaler Kooperation in der Wirtschafts-politik (Bretton-Woods-Sytem) eine Stabilisierung der ökonomischen Systeme. Durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs allerdings ging diese Zusammenarbeit und ebenso die koordinierte Rezessions-bekämpfung weitestgehend verloren.
In der Europäischen Union wurde die Konjunkturpolitik im Gegensatz zur USA auf die Geldpolitik beschränkt und antizyklische Budgetpolitik verteufelt.
Auch die stabile Lohnquote, durch die die Massenkaufkraft gesichert wurde, fiel der neoliberalen Konterrevolution zum Opfer. In den letzten Jahrzehnten ging sie in den europäischen Ländern stark zurück, da die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften durch hohe Arbeitslosigkeit und die Drohung der Produktionsverlagerung gebrochen werden konnte.
Nur die technische Innovation (und die antizyklische Politik der USA) ist der noch einzige dieser Faktoren, der der von Steindl beschriebenen Schwächetendenz oligopolistischer Wirtschaften heute noch entgegenwirkt.
Daher erscheint es nur logisch, dass die Depressionsphase in der Euro-Region nach dem Einbruch durch die Wirtschaftskrise mehr als doppelt so lange anhielt wie in früheren Konjunkturzyklen.
Die dieser Problematik zugrunde liegende Politik der Preisstabilität und Haushaltskonsolidierung ohne gleichwertige Berücksichtigung von Wachstum und Beschäftigung bezeichnete Josef Steindl als „Stagnationspolitik“.
So sei es auch vor allem die Veränderung der politischen Haltung -und weniger die objektiven ökonomischen Gründe- gewesen, die die Wachstumsraten der fünfziger und sechziger Jahre halbiert hätten und damit zu Massenarbeitslosigkeit führten.
Heute ist diese durchgehend hohe Beschäftigungslosigkeit wieder zu dem zentralen wirtschafts-politischen Problem in Europa geworden, verschärft noch durch die unsinnige Austeritätspolitik seit der Eurokrise. Nach Steindl ist es endgültig an der Zeit, die „Bourbonen“ des Feudalismus wieder zu vertreiben und zurück zu dem Weg zu finden, mit dem früher Vollbeschäftigung erreicht wurde.
Zusammen mit seinem Lehrmeister Kalecki erarbeitete Steindl einen der wichtigsten Gründe, weshalb gerade auch die Unternehmen letztlich eine Abkehr von der Politik der Vollbeschäftigung anstrebten:
– durch die Reduzierung der Arbeitslosigkeit werde die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und Betriebsräte gestärkt, während das Gegenteil diese zugunsten der Unternehmen verschiebt,
– damit seien dann auch gesteigerte Forderungen nach voller Teilhabe der Beschäftigten an der Produktivitätszunahme, Mitbestimmung und einer Ausdehnung des Sozialstaates verknüpft, die in der heutigen Diskussion dagegen fast vollständig in den Hintergrund getreten sind.
So trifft Steindls Beschreibung einer absichtlichen Stagnationspolitik auf wesentliche Elemente des ökonomischen Rahmens der Europäischen Union zu. Obwohl der Maastrichter Vertrag vor allem Stabilität und Wachstum versprochen hatte, dominieren heute eine schwache Konjunktur und hohe Erwerbslosigkeit.
1988 stellte Josef Steindl in einem kurzen Essay seine Kritik an der Wirtschaftspolitik der EU besonders heraus: er verglich das „Europa der EU“ mit dem „Europa nach Keynes“ und stellte fest, dass eine ökonomisch erfolgreiche EU die gemeinsamen Interessen herausstellen und vor allem für einen Ausgleich zwischen Schuldner- und Gläubigerländern sorgen müsse.
Es müsse zudem verhindert werden, dass Staaten mit hohen Defiziten in der Leistungsbilanz zu massiven restriktiven Handlungen gezwungen werden, durch die Arbeitslosigkeit und Rezession entstehen.
Angesichts der Auswirkungen der Eurokrise eine erschreckend aktuelle Einschätzung, gerade was auch die Probleme der Südeuropäer angeht.
Entgegen der heutigen Betonung der Angebotspolitik in der EU, deren Bilanz schon Steindl als äußerst dürftig voraussah, trat er immer für eine expansive Wirtschaftspolitik mit einer langfristig ausge-richteten Nachfragestimulierung ein. Damit grenzte sich Steindl klar von der neoklassischen Theorie ab.
Wichtig war ihm dabei vor allem, dass die Nachfragepolitik nicht nur auf die kurze Frist beschränkt sei, eine Trennung von Konjunkturzyklus und langfristigem Trend (wie sie die moderne neoliberale Wirt-schaftspolitik predigt) lehnte er entschieden ab.
In drei Bereichen hielt Steindl eine langfristig orientierte Nachfragepolitik für besonders notwendig: bei der Stimulierung von Innovationen, der Reduzierung der Sparquoten und der besseren Zusammenarbeit der internationalen Politik.
Für die Stagnation nach 1975 war nach Steindl vor allem die hohe Sparneigung der privaten Haushalte verantwortlich. Die steigenden Sparraten als das Ergebnis wachsenden Lebensstandards führen zu mangelnder Konsumnachfrage, die empirische Analyse anhand der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung erklärt diesen Zusammenhang:
Wenn die privaten Haushalte mehr sparen, dann dämpft dies Konsumnachfrage, BIP und Gewinne, die Schulden des Staates, der Unternehmen oder des Auslandes müssen daher steigen, da die Summe der Finanzierungssalden aller Gruppen logischerweise stets null ergibt.
Steindl verließ sich immer auf die Empirie und achtete darauf, gesamtwirtschaftliche Phänomene nicht mit individuellen Handlungen zu verwechseln. So war für ihn das Sparen keineswegs eine Frage der Moral wie bei Friedrich August von Hayek oder eine Voraussetzung für Investitionen, wie es von den Neoklassikern gesehen wird.
Auch heute bestätigt der Vergleich der ökonomischen Entwicklung der Industriestaaten die Ansichten Steindls über das Sparen. In den letzten Jahren war vor allem in den Ländern das Wirtschafts-wachstum hoch, in denen der gesparte Anteil des Einkommens gesunken war. Die Staaten mit steigender Sparneigung der privaten Haushalte dagegen litten unter schwachem Wachstum und Arbeitslosigkeit.
Das Auseinanderbrechen des Bretton-Woods-Systems mit dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen sowie die Erosion gesamtwirtschaftlicher Lohnvereinbarungen galten Steindl als Beispiele für den Niedergang der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit.
Auch die Probleme der EU, die ja eigentlich mit dem Ziel der verbesserten Kooperation zwischen den Staaten gegründet worden war, lassen sich mit mangelnder ökonomischer Zusammenarbeit in den Bereichen der Haushaltspolitik, des schädlichen Steuerwettbewerbs sowie der fehlenden Abstimmung der Geldpolitik und Lohnpolitik erklären.
Es sei vor allem die politische Einstellung zugunsten von Preisstabilität, Sparpolitik und Wettbewerb auf Kosten von Wachstum, Beschäftigung und Verteilung, durch die die EU ihre wirtschaftlichen Potentiale nicht ausnutzen könne.
Der eklatante Gegensatz zwischen Steindls Theorien und dem Brüsseler Konsens von EU-Kommission und OECD könnte eigentlich nicht gravierender sein. Die Misserfolge der EU-Politik auch und gerade in der Euro-Krise sollten Europa langsam aufrütteln. Doch tatsächlich schlummern Steindls Ideen weiter im Verborgenen und die EU stümpert vor sich hin.
Und wenn man heute Bundesfinanzminister Lindner zuhört, weiß man, dass die neoliberalen Ideen in den Institutionen Deutschlands und der EU immer noch bestimmend sind und trotz fortwährendem Scheiterns immer wieder hervorgeholt werden.