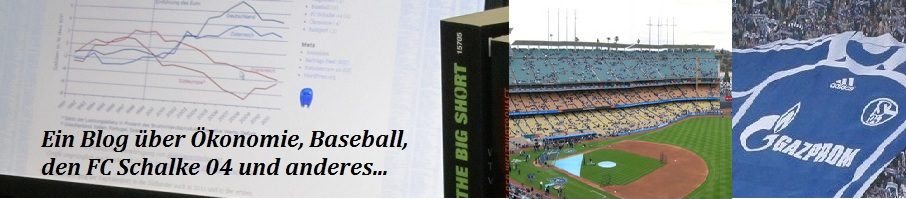Wenn ich Konzepte wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwähne, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Diskussionen über die Vorzüge von „Wachstum“ und „Degrowth“ ausbrechen. Fast ausnahmslos stecken diese Argumente in einem konzeptionellen Rahmen fest, der seit 50 Jahren oder sogar noch länger veraltet ist.

Das Braunkohlekraftwerk Eschweiler-Weisweiler (Betreiber RWE) im Sonnenaufgang
Das System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei dem das BIP ein zentraler Bestandteil ist, wurde in den 1930er Jahren eingeführt. Es wurde entwickelt, um die Funktionsweise der industriellen Wirtschaft zu messen, die im 19. Jahrhundert entstanden war und bis zum Ende des 20. Jahrhunderts die dominierende Form der wirtschaftlichen Aktivität blieb.
Die industrielle Ökonomie könnte konzeptionell in drei Sektoren verstanden werden. Primärindustrien wie Landwirtschaft und Bergbau produzierten Rohstoffe. Die Sekundärindustrie (verarbeitendes Gewerbe, im weitesten Sinne) verwandelte Rohstoffe in nützliche Produkte. Die Tertiärindustrie (Dienstleistungen wie Groß- und Einzelhandel) brachte die Produkte von der Fabrik zum Verbraucher.
Andere Dienstleistungen wie Buchhaltung, Finanzen und Recht schmierten die Räder des gesamten Prozesses. Aktivitäten wie Bildung und Gesundheit, die nicht wirklich in das Modell passten, wurden als Reproduktion und Pflege der Arbeitskräfte angesehen, die benötigt wurden um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Schließlich wurden die Abfallprodukte des Systems verbrannt oder deponiert.
In der industriellen Wirtschaft umfasste das Wachstum eine wachsende Zahl von Arbeitern, von denen jeder mehr von allem produzierte: mehr Primärprodukte, die zu mehr Industriegütern verarbeitet wurden, die in größeren und besseren Geschäften verkauft wurden und immer mehr Abfall erzeugten.
Wachstum wurde in erster Linie dadurch erreicht, dass die Arbeiter mit mehr Kapital ausgestattet wurden, das den Arbeitgebern gehörte (daher der Begriff „Kapitalismus“, um diese Wirtschaft zu beschreiben). Differenziertere Analysen berücksichtigten den technologischen Fortschritt und das „Humankapital“, d. h. die Fähigkeiten, die die Arbeitnehmer durch allgemeine und berufliche Bildung erwerben.
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde deutlich, dass dieser Prozess nicht unbegrenzt weitergehen konnte. Wie regelmäßig beobachtet wurde, ist ein unendliches Wachstum der Produktion physischer Güter auf einem endlichen Planeten unmöglich.
Wie sich jedoch herausstellte, markierte die Mitte des 20. Jahrhunderts den Anfang vom Ende der industriellen Ökonomie. Der Dienstleistungssektor oder „tertiärer“ Sektor machte 1950 die Hälfte der US-Beschäftigung aus, und dieser Anteil ist heute stetig auf etwa 80 % gestiegen.
Im Dienstleistungssektor sind immer weniger Arbeitnehmer mit den „tertiären“ Aktivitäten beschäftigt, nämlich der Verteilung der Produktion von Bauernhöfen und Fabriken durch Einzelhandel, Großhandel und Transport. Viele weitere arbeiten entweder in direkt erbrachten menschlichen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Gastgewerbe. Aber das wirklich spektakuläre Wachstum war bei „Bürojobs“ zu verzeichnen, die auf die eine oder andere Weise mit Informationen zu tun haben.
Das Industriemodell, in dem sich alle Stufen des Produktionsprozesses proportional ausdehnen, ist – zumindest in reichen Ländern – nicht mehr relevant. Die Produktion physischer Güter und insbesondere der charakteristischen Produkte der industriellen Wirtschaft des 20. Jahrhunderts (Autos, Haushalts-geräte usw.) hat sich weitgehend stabilisiert. So schwankt beispielsweise die Zahl der in den USA verkauften Kraftfahrzeuge seit 1980 um die Marke von 15 Millionen pro Jahr, obwohl die US-Bevöl-kerung gewachsen ist.
In der Zwischenzeit hat die Produktion und Verbreitung von Informationen so schnell zugenommen, dass sie sich den traditionellen Messmethoden und jeder Art von Intuition über Wachstum widersetzt. Die Menge an Informationen, die wir generieren (ob nützlich oder trivial), ist seit dem Aufkommen des elektronischen Computers um etwa 60 % pro Jahr gewachsen.
Um eine Intuition zu geben, bedeutet das, dass wir jede Millisekunde kollektiv so viele Informationen generieren wie in einem ganzen Jahr in den 1970er Jahren. Ein Konzept von „Wachstum“, das solche unvorstellbaren Expansionsraten mit der nahezu stationären Produktion von Autos, Kühlschränken und so weiter verbindet erscheint bedeutungslos.
Und wenn „Wachstum“ bedeutungslos ist, ist es auch „Degrowth“. Es gibt keinen technologischen oder ökologischen Grund, warum wir nicht immer mehr Dienstleistungen anbieten können, von Gesundheit und Bildung bis hin zu TikTok-Videos.
Und wenn wir die Technologie weiter verbessern können, gibt es keine wirkliche Grenze für unsere Versorgung mit Solar- und Windenergie. Was wir reduzieren müssen, ist der „Durchsatz“ der industri-ellen Restwirtschaft, angefangen bei der Gewinnung von Ressourcen bis hin zur Deponierung von Abfällen. Hier bleiben Ideen wie die der „Kreislaufwirtschaft“ relevant.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weder „Wachstum“ noch „Degrowth“ als langfristiges Ziel der Wirtschaftspolitik sinnvoll sind. Das bedeutet nicht, dass das BIP als statistisches Maß unbrauchbar ist. Wenn das BIP von einem Jahr zum nächsten stark sinkt, liegt das in der Regel nicht daran, dass sich eine Gesellschaft weniger um materielle Güter und vermarktete Dienstleistungen kümmert.
Vielmehr sind starke Rückgänge des BIP, wie sie während der globalen Finanzkrise und der „Rezession, die wir haben mussten“ Anfang der 1990er Jahre, in der Regel auf externe Schocks oder wirtschaft-liches Missmanagement zurückzuführen. BIP-Statistiken liefern Wirtschaftspolitikern wertvolle Informationen über den kurzfristigen Zustand der Wirtschaft.
Auf lange Sicht ist das BIP jedoch kein nützliches Maß. Und in einer Wirtschaft, die den stark divergie-renden Trends unterliegt, die wir heute beobachten, ist es wenig sinnvoll, nach einer einzigen Zahl (z. B. einem statistischen Maß für Glück) zu suchen, die sie ersetzt.
Wir können und sollten ein besseres und reicheres Leben anstreben und gleichzeitig den Schaden verringern und reparieren, den die industrielle Ökonomie unserer natürlichen Umwelt und vor allem dem globalen Klima zugefügt hat.
(Eigene Übersetzung eines Blogbeitrages des australischen Ökonomen John Quiggin)