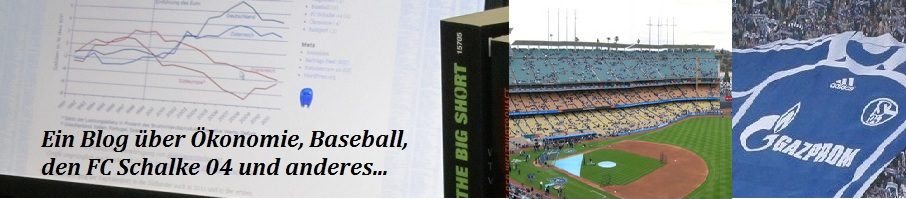Holt der Rest der Welt gegenüber den führenden Ländern auf? Das hängt vom Thema ab. Wenn Sie von wirtschaftlicher Produktivität sprechen, bleibt die Antwort eher unklar. Reden Sie über Fußballergebnisse, so ist das allerdings eine andere Geschichte.

Für die Fußball-WM 2018 qualifizierte Staaten
Wenn wir den Fußball erst einmal beiseite legen (keine Angst – nicht für lange), sollten wir uns stattdessen auf den Lebensstandard aller Menschen auf diesem Planeten konzentrieren. „Konvergenz“ – die Idee, dass arme Länder schneller wachsen als reiche – ist da ein wichtiger Ansatz.
In einem sehr armen Land sollte die Rendite einiger einfacher Investitionen eigentlich sehr hoch ausfallen. Der Bau einer asphaltierten Straße zwischen zwei Städten macht einen größeren Unterschied als das Hinzufügen einer neuen Fahrspur zu einer Straße, die bereits existiert. Gleiches gilt für Stromleitungen, Eisenbahnen und Häfen. So sollte Kapital in ärmere Länder fließen und sie sollten schneller wachsen als reiche Staaten.
Das ist zumindest die Theorie, und es erscheint plausibel, wenn man über das schillernde Wachstum von Japan und Deutschland in der Nachkriegszeit, Südkorea in den siebziger und achtziger Jahren, China und oft übersehene Erfolgsgeschichten wie etwa Äthiopien nachdenkt.
Wenn arme Länder schnell wachsen, entfliehen Menschen der Armut, und die globale Ungleichheit nimmt tendenziell ab. Wenn Konvergenz der natürliche Zustand der Dinge wäre, wäre das eine gute Nachricht. Jedoch hat es mit den Worten des Ökonomen Dani Rodrik „die empirische Arbeit nicht besonders gut mit diesem Vorschlag gemeint“. Die grobe historische Tatsache ist die, dass die Weltwirtschaft zwischen 1820 und 1990 stark auseinander driftete, wobei die heutigen reichen Nationen ihren Anteil am Welteinkommen von 20 auf 70 Prozent ausgeweitet haben.
Dieser Trend hat sich seither scharf umgedreht, so Richard Baldwin, ein Ökonom und Autor von The Great Convergence. Allerdings, so der Professor, bleibt dieser Aufholprozess bisher hoch konzentriert. Zwischen 1970 und 2010 wuchsen die sechs großen Industrieländer China, Korea, Indien, Polen, Indonesien und Thailand von nahezu Null zu mehr als einem Viertel der weltweiten Produktion. Währenddessen schrumpften die G7-Staaten von zwei Dritteln auf 50 Prozent. Der Rest der Welt blieb dabei nahezu unverändert.
So haben Ökonomen die Idee der Konvergenz als universelles Phänomen eigentlich weitestgehend aufgegeben. Sie sprechen stattdessen von „bedingter Konvergenz“. Konvergenz wird Venezuela und Nordkorea Wahrscheinlich nicht vor katastrophalen Regierungen retten, jedoch könnte genau das geschehen, wenn man die richtige Kombination aus Politik, Institutionen und ökonomischem Elfenstaub fände. Wie diese Kombination dann aber aussähe und warum einige Nationen offenbar vergeblich darum kämpfen sie zu erreichen, bleibt dabei die Billionen-Dollar-Frage.
Prof. Rodrik hat Hinweise dafür gefunden, dass eine bedingungslose Konvergenz nicht für Volkswirtschaften als Ganzes, sondern eher nur für bestimmte Produktionssektoren in diesen Volkswirtschaften wie etwa „Makkaroni und Nudeln“ oder „gestrickte oder gehäkelte Bekleidung“ oder „Kunststoffsäcke und -taschen“ funktionieren kann.
Wenn ein solcher Sektor weit hinter der globalen Spitze zurückbleibt, kann er erwarten, dass die Arbeitsproduktivität um 4-8 Prozent pro Jahr wächst, genug, um sich alle ein oder zwei Jahrzehnte zu verdoppeln. Diese Tendenz gilt unabhängig davon, was sonst in der Wirtschaft passieren könnte. Warum?
Die wahrscheinlichste Antwort lautet, dass solche Fertigungssektoren in globale Lieferketten mit einbezogen werden. Sie können schnell lernen und müssen zügig auf die ständige Bedrohung durch den Wettbewerb reagieren. Sie machen dabei Geschäfte mit Lieferanten und Kunden, die schnell Feedback und Anweisungen geben können.
In der modernen Weltwirtschaft verbreiten sich bestimmte Arten von Know-how recht schnell, kleinere Aufgaben werden entbündelt, und teilfertige Güter und Komponenten pendeln über Grenzen hinweg hin und her. Jedes Unternehmen, welches an diesen Prozessen beteiligt ist, wird sich in der Regel zügig verbessern. Es könnte stärker in globale Lieferketten integriert sein als seine eigene lokale Wirtschaft, die ansonsten möglicherweise nicht mithalten kann.
All das bringt uns zurück zum Fußball. Zwei Ökonomen, Melanie Krause und Stefan Szymanski, entschieden sich dazu zu überprüfen, ob die unbedingte Konvergenzhypothese für den internationalen Herren-Fußball ebenso gilt wie für das produzierende Gewerbe. (Co-Autor ist Prof. Szymanski übrigens gemeinsam mit Simon Kuper von der Financial Times, Verfasser von Soccernomics) Das Spiel mit dem runden Leder bietet schließlich einen sehr umfangreichen Datensatz und einige klare Leistungskennzahlen an. Der internationale Fußballverband Fifa hat dabei mehr Mitglieder als die UNO.
Tatsächlich fanden die Professoren Krause und Szymanski heraus, dass die Stärke der internationalen Fußballmannschaften immer mehr „konvergiert“. Die „Kleinen“ zeigen Biss, und das alte Klischee „es gibt keine leichten Spiele mehr im internationalen Fußball“ trifft heute viel mehr zu als 1950.
Vielleicht sollten wir darüber nicht zu sehr überrascht sein. Wie auch in der Produktion ist das Niveau des Wettbewerbs hefig, Leistungen werden unerbittlich gemessen und die besten Ideen natürlich sofort kopiert. Als zusätzlichen Ansporn für den Fortschritt bietet der Elitefußball einen globalen Arbeitsmarkt: Ein starker Spieler aus einer schwachen Nationalmannschaft wird die meiste Zeit mit erstklassiger Betreuung, Trainern und Teamkameraden in einer Top-Klubmannschaft verbringen. Seine Heimat-Nation wird dann von diesen Vorteile profitieren.
Es ist natürlich verlockend, aus all dem große Schlussfolgerungen zu ziehen, von der wachsenden Bedeutung des Wissens bei der Globalisierung über die Auswirkungen des robusten internationalen Wettbewerbs sowie die Vorteile der Öffnung für internationale Migranten. Doch vielleicht ist es schlicht besser, einfach nur Fußball zu schauen. In einer Zeit der quälenden Reality-TV-Politik ist das zumindest ein Wettbewerbsspektakel, welches wir (fast) alle genießen können.
(Eigene Übersetzung eines Blogbeitrages des britischen Ökonomen Tim Harford)