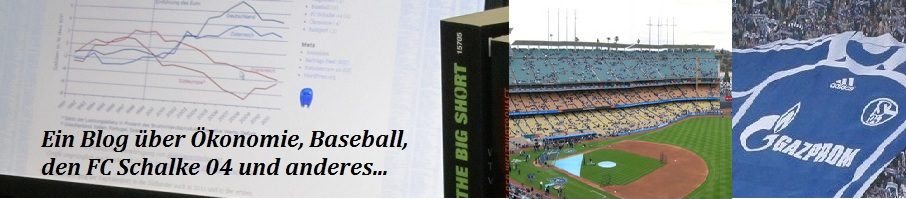„Vom kranken Mann Europas zum Musterknaben“
Immer wieder, wenn auch nur leise Kritik an der deutschen Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte geäußert wird, wenn wieder einmal jemand den deutschen Exportüberschuss kritisiert und in der deutschen Lohnzurückhaltung einen Hauptgrund für die derzeitige Krise der Euroländer sieht, wird sie hervorgeholt:

Deutsche Briefmarke zur Euroeinführung
Die Erzählung vom kranken Mann Europas, der sich mit schmerzlichen und ein-schneidenden Reformen fit gemacht und nun dadurch die Rolle der „Wachstums-lokomotive“ in der Europäischen Union übernommen habe.
Was aber ist tatsächlich dran an dieser Geschichte? War Deutschland bei der Euro-Einführung tatsächlich dieser „kranke Mann“?
Und wenn ja, was waren die wirklichen Gründe für diese schlechte Wirtschaftslage? Waren es die zu hohen Löhne und der überbordende Sozialstaat, wie es Hans-Werner Sinn, der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung damals immer wieder behauptete?
Sinn gehörte seit den 1990ern zu den geistigen Vätern und Wegbereitern der “Agendapolitik“. Seiner Ansicht nach konnten nur noch kräftige Kostensenkungen Deutschland wieder auf einen Wachstumspfad zurückbringen. Das Lohnniveau und die Soziallasten waren angeblich zu hoch, als dass sich Arbeit in Deutschland noch hätte lohnen können. Deutschland habe, so lautete Sinns Credo, die internationale Wettbewerbsfähigkeit verloren.
In der Tat fiel das Wachstum der Wirtschaftsleistung in der ersten Hälfte der letzten Dekade sehr schwach aus: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs jahresdurchschnittlich real lediglich um 0,6%. Das war nach den Daten von Eurostat eine deutlich geringere Zunahme als in der gesamten EU (1,8%) oder in der Eurozone – und ein viel geringeres Wachstum als etwa in Spanien oder Griechenland.
Das Platzen der Technologieblase im Frühjahr 2000 traf Deutschland zusätzlich hart: Der zuvor hochgejubelte Neue Markt in Frankfurt brach um über 90 Prozent ein.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts hatte daher auch so gut wie niemand mehr angenommen, dass in Deutschland wieder einmal Wachstumsraten von mehr als einem Prozent erzielt werden könnten. Damit schien auch jede Möglichkeit, die Massenarbeitslosigkeit deutlich senken zu können, ferner denn je zu sein. Der kranke Mann Europas schien ein hoffnungsloser Fall zu sein.
Interessanterweise aber liefen vor allem die Binnennachfrage und die Exporte damals erheblich auseinander. Die Binnennachfrage schrumpfte von 2000 bis 2005 im Jahresdurchschnitt um 0,4%, die Exporte zogen mit einer allmählich einsetzenden weltweiten Erholung mehr und mehr an und übertrafen deutlich die Importe.
Für eine strukturelle Wettbewerbsschwäche, wie sie damals dem Exportweltmeister Deutschland diagnostiziert wurde, sprach das eigentlich nicht. Trotzdem wurde als Therapie, da waren sich fast alle mit Sinn einig, Lohnzurückhaltung verschrieben.
Doch mit der Vorbereitung auf die Europäische Währungsunion hatte sich bereits die Rolle der Lohnpolitik in Deutschland fundamental geändert. 1999 wurde das von der Politik ins Leben gerufene „Bündnis für Arbeit“ beschlossen, mit der Absicht, die „Produktivität für die Beschäftigung zu reservieren“.
Bereits seit 1982, als das „Lambsdorff-Papier“ den Regierungswechsel zur CDU/FDP-Koalition unter Kanzler Helmut Kohl einläutete, betrieb Deutschland eine Politik der „Verbilligung der Arbeitskosten“ und „Senkung der Sozialbeiträge“, ohne dabei etwas gegen die steigende Massenarbeitslosigkeit ausrichten zu können. Zur Einführung des Euros aber zog man nicht etwa die Konsequenzen aus dieser wirkungslosen Politik, sondern verschärfte sie noch.
In der Folge sanken daher die Lohnstückkosten, also die Löhne im Verhältnis zur Produktivität, in Deutschland unter die eigentlich für alle EU-Länder mit der Europäischen Zentralbank (EZB) vereinbarten Zielinflationsrate von 2 %, während sich die übrigen Staaten leicht darüber hielten.
Eigentlich hätte damals in Deutschland geldpolitisch gegengesteuert werden müssen, da sich die gesamtwirtschaftliche Lage an der Kippe zu einer Deflation bewegte. Doch mit der Einführung des Euro und der Übergabe der Geldpolitik an die EZB galt nun für den gesamten Währungsraum ein einheitlicher Leitzinssatz. Es gab keine eigenständige deutsche Geldpolitik mehr.
Die EZB aber musste die wirtschaftliche Entwicklung und den Anstieg der Inflation in allen Ländern der Eurozone im Auge haben – und in manchen Staaten war man auf dem besten Weg in einen regelrechten Konsum- und/oder Immobilienboom. Für diese Länder war die Geldpolitik zu locker, für Deutschland war sie zu restriktiv.
Es wurde letztlich ein niedriges Zinsniveau festgelegt, ganz im Sinne der deutschen Politik. Für die meisten anderen Länder wäre ein höherer Zins dringend notwendig gewesen, da ihnen eine Überhitzung der Konjunktur drohte.
Ironie der Geschichte: ausgerechnet die deutschen Monetaristen um Hans-Werner Sinn erstritten eine Politik des billigen Geldes (womit sie natürlich später nichts mehr zu tun haben wollten).
Entgegen landläufiger Meinung beruhte die Verbesserung der deutschen Wettbewerbs-fähigkeit daher auch nicht primär auf höheren Produktivitätszuwächsen, sondern auf Einfrieren deutscher Löhne, auf Schwächung des Binnenkonsums durch eine (3%-ige) Umsatzsteuer-Erhöhung und auf einer Güterpreis-Inflationsrate unterhalb des von der EZB vorgegebenen Ziels von 2%.
Das Kleinhalten der eigenen Binnennachfrage generierte finanzielle Sparüberschüsse, die als Geldströme ins Ausland gelangen und die Nachbarländer (via Billigkredit) zum Konsum der eigenen Produkte veranlassten. Logischerweise sanken die Investitionen in Deutschland daraufhin förmlich ins Bodenlose, während sie in den anderen Staaten von höheren Löhnen und Konsum angezogen wurden.
In dieser Zeit floss daher auch viel ausländisches Kapital, insbesondere vor allem deutsche Ersparnisse, in die anderen EWU-Länder. Das billige Geld löste in den Südländern einen Nachfrageboom aus, der insbesondere dem deutschen Export zugute kam. In Spanien und Irland wurden dadurch die Immobilienblasen erzeugt, die später in der Krise die öffentlichen und privaten Haushalte in den Ruin trieben.
Deutschland bremste also politisch ganz bewusst seine eigene Binnennachfrage mit dem Ziel, Exportüberschüsse einzufahren. Diese Politik konnte im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre funktionieren, weil Deutschlands Nachbarn nicht dieselbe Wirtschaftspolitik betrieben und weil durch die Zugehörigkeit zur gleichen Währungszone Deutschlands Währung nicht aufgewertet wurde.
Wenn man denn überhaupt von der Geschichte vom kranken Mann Europas etwas lernen will, so ist es die Tatsache, dass es sich dabei um eine selbst verschuldete und verstärkte „Krankheit“ handelte, verursacht hauptsächlich durch falsche deutsche Wirtschaftspolitik.
Die deutsche Wirtschaft wies während der schlechten Jahre keineswegs überdurch-schnittlich „verkrustete“ Arbeitsmärkte auf, sondern wurde durch eine ungewöhnlich schwache Binnennachfrage aufgrund einer ausgabenseitig restriktiven Finanzpolitik und einer extrem schwachen Lohnentwicklung ausgebremst.
Der Aufschwung gelang erst, als die Finanzpolitik gelockert wurde und sich die starken außen- wirtschaftlichen Impulse auf die Binnenwirtschaft übertragen konnten.
Inzwischen weisen Studien zudem nach, dass eine andere, nicht nur einseitig auf angebotsseitige Strukturreformen konzentrierte Politik erfolgreicher gewesen wäre.
Trotzdem erfreut sich diese „Erzählung“ einer enormen Beliebtheit vor allem bei konservativen Publizisten und Politikern, die nicht müde werden, diesen Abschnitt der deutschen Geschichte als Erfolg zu verkaufen.
Progressive Geister sollten es allerdings besser wissen.