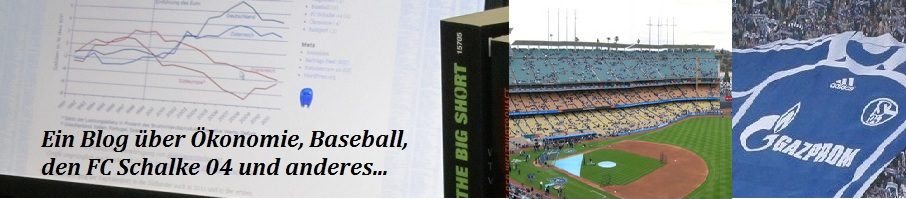Wenn es heute ein Schlagwort gibt, welches den meisten Menschen Unbehagen bereitet, dann ist das die „Globalisierung“.
Denn es ist genau dieses Stichwort, das immer wieder als Begründung herhalten muss, wenn die Politik wieder einmal „Alternativloses“ durchsetzen möchte.
Zumeist handelt es sich dabei auch noch um Verschlechterungen des aktuellen Status Quo, und alle beeilen sich schnell zu versichern, dass solche Maßnahmen „im Zuge der Globalisierung unabwendbar“ seien.

Was aber ist da wirklich dran an den angeblichen unabwendbaren Zwängen, die uns durch die Globalisierung vorgegeben werden? Ist es tatsächlich notwendig, dass wir unsere sozialen Errungenschaften opfern müssen, um ihm weltweiten ökonomischen Wettstreit bestehen zu können?
Nun, bei dem Versuch, diese Fragen zu klären, ist mir ein Buch des türkischen Ökonomen Dani Rodrik mit dem Titel Das Globalisierungs-Paradox in die Hände gefallen.
Anders als gedacht: Warum offenere Gesellschaften einen stärkeren Staat haben
Schon in der Einleitung zu seinem Buch erregt Rodrik Aufsehen, in dem er sich klar von der herrschenden neoliberalen Sicht auf die Weltwirtschaft abgrenzt.
Er schreibt dort:
Ich möchte in diesem Buch ein Alternativszenario präsentieren, das auf zwei simplen Gedanken fußt:
Erstens: Markt und Staat schließen einander nicht aus, sondern ergänzen einander. Wer mehr und bessere Märkte will, muss mehr (und bessere) staatliche Kontrolle herbeiführen. Märkte funktionieren am besten nicht dort, wo sie es mit einem schwachen, sondern dort, wo sie es mit einem starken Staat zu tun haben.
Zweitens: es gibt nicht nur eine Spielart des Kapitalismus. Wirtschaftlicher Wohlstand und Stabilität lassen sich durch vielfältige Kombinationen institutioneller Arrangements von Arbeitsmarkt, Finanzwesen, Unternehmenskultur, Sozialpolitik und anderen Faktoren herbeiführen und sicherstellen.
Rodrik beginnt sein Buch mit einem unterhaltsamen und informativen Rückblick auf die Anfänge der Globalisierung.
Der Handel mit Biberfellen ist für ihn einer der Ursprünge des weltweiten Handels. Anhand der daraus entstandenen Hudson’s Bay Company erläutert er den merkantilistischen Charakter des ersten länderübergreifenden Handelssystems.
Schon damals sei eine umfassende Globalisierung nur mit einer starken institutionellen Infrastruktur möglich gewesen, um die Ungewissheiten und Gefährdungen, denen ein solch aufwendiges Handelsunterfangen ausgesetzt war, überhaupt bewältigen zu können.
Kompanien wie die Hudson’s Bay-, die Ostindien- oder die Royal African Kompanie erhielten dabei umfangreiche Monopolrechte, mussten aber im Gegenzug quasi-staatliche Aufgaben wie die Sicherung der Handelswege oder die Erschliessung neuer Märkte übernehmen.
Dani Rodrik verfolgt diese Gedanken bis in die 1990er Jahre, in der ihm zu Überlegungen über die notwendige Größe des öffentlichen Sektors eine Studie mit überraschendem Ergebnis bekannt wurde:
The Expansion of the Public Economy
Der Politologe David Cameron hatte darin untersucht, warum der staatliche Anteil in den führenden Industrienationen nach dem zweiten Weltkrieg so rasant gestiegen war.
Das Ergebnis war erstaunlich: Der öffentliche Sektor war am meisten in den Staaten gewachsen, die auch am stärksten dem globalen Handel ausgesetzt waren.
Aufgrund des vorherrschenden Dogmas vom „schlanken Staat“ als Vorraussetzung für erfolgreiches globales Handeln zweifelte Rodrik an der Aussagefähigkeit von Camerons Ausführungen und stellte selbst Nachforschungen an.
Doch auch er konnte die Grundaussagen dieser Arbeit nicht widerlegen. Im Gegenteil kam Rodrik immer mehr zu der Überzeugung, dass Cameron recht hatte.
Eine eigene Studie (Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?) und eine weiterführende Arbeit von Giuseppe Bertola und Anna Lo Prete (2008) Openness, financial markets, and policies: Cross-country and dynamic patterns ließen ihn zu grundsätzlich anderen Annahmen als Voraussetzungen zur erfolgreichen Teilnahme am weltweiten Handelsgeschehen kommen.
Das politische Trilemma der Weltwirtschaft
Rodrik bündelt seine Analyse in dem Schluß, dass die drei Vorhaben Demokratie, nationale Selbstbestimmung und wirtschaftliche Globalisierung nicht zeitgleich verwirklicht werden können.
Seiner Ansicht nach kranken globale Märkte unter schwacher Kontrolle und sind deshalb „anfällig für Instabilität, Ineffizienz und einen Mangel an demokratischer Legitimation“. Die Bilanz der „finanziellen Globalisierung“ fällt für ihn eher bescheiden aus, alles in allem hat sie „eher zu mehr Instabilität als zu mehr Investitionen und höherem Wachstum“ geführt.
Gerade die Entwicklungsländer haben bei dieser Entwicklung erhebliche Rückschritte in ihrer ökonomischen Prosperität hinnehmen müssen.
Dani Rodrik ist kein strikter Globalisierungsgegner, doch er legt den Finger genau in die Wunden der herrschenden Wirtschaftstheorie, die einen „grenzenlosen Freihandel“ als unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am weltweiten Handelsmarkt ansieht.
Er stellt fest, dass diese neoliberale Ideologie die jüngst entstandenen Krisen überhaupt erst möglich gemacht habe.
Nationale Demokratie und „tiefe Globalisierung“ sind nach Rodriks Überzeugung nicht miteinander vereinbar:
Die politische Demokratie wirft einen langen Schatten auf die Finanzmärkte und beraubt jede nationale Regierung der Möglichkeit, ihr Land tief in die Weltwirtschaft zu integrieren.
Sieben Grundsätze für einen modernisierten weltweiten Kapitalismus
Rodrik bietet als Lösung einen „Kapitalismus 3.0“ an, der nach der ersten Variante der Marktwirtschaft, dem Imperialismus mit einer Minimalfassung der notwendigen staatlichen Institutionen, eine verbesserte Neufassung der Version 2.0, der „gelenkten Volkswirtschaft“ des Zwanzigsten Jahrhunderts mit einem hohen Staatsanteil (ähnlich dem Bretton-Woods-System) anbieten soll.
Dieses Modell soll zwei entscheidende Versäumnisse der neoliberalen Hyperglobalisierung ausgleichen: den notwendigen Unterbau der staatlichen Institutionen, ohne den eine rasche und tiefe Integration in die Weltwirtschaft nicht störungsfrei möglich sei.
Zudem soll es die (falsche) These der grundsätzlich nicht vorhandenen oder nur positiven Auswirkungen der ungehemmten Globalisierung auf die Strukturen des Staates im Inland berichtigen.
Als Grundgerüst einer zukünftigen Weltwirtschaft stellt Rodrik sieben Grundsätze zur Diskussion, die seiner Meinung nach notwendig sind, um den Herausforderungen einer demokratischen Globalisierung gewachsen zu sein:
1. Märkte müssen in politische Ordnungssysteme eingebettet werden
2. Demokratische Entscheidungsstrukturen werden nach wie vor überwiegend von den Nationalstaaten organisiert
3. Es gibt verschiedene institutionelle Wege zum Wohlstand
4. Länder haben grundsätzlich das Recht, ihre eigenen staatlichen und sozialen Strukturen zu verteidigen
5. Länder haben nicht das Recht, anderen ihre Institutionen aufzuzwingen
6. Internationale Wirtschaftsabkommen sollen Regeln für die Schnittstellen zwischen nationalen Institutionen festlegen
7. Nicht-demokratische Länder können nicht dieselben Rechte und Privilegien innerhalb der internationalen Wirtschaftsordnung erhalten wie Demokratien
Fazit:
„Das Globalisierungs-Paradox“ ist für mich eines der wichtigsten Wirtschafts-Bücher überhaupt, da es klare Ansichten zu den oft nebulösen „alternativlosen“ Erfordernissen der wirtschaftlichen Globalisierung liefert.
Sollte demnächst mal wieder jemand behaupten, dass es unbedingt notwendig sei, zum volkswirtschaftlichen Überleben einige schmerzhafte „Reformen“ durchführen zu müssen, so könnte jeder aufmerksame Leser dieses Buches eine kritische Analyse der angegebenen Gründe vollziehen.
Schon allein deshalb halte ich dieses Buch in der ökonomischen Diskussion für unverzichtbar.